Die Nationalparks von Banff und Jasper – Schon schön, aber na ja,…
Endlich, nach der zwar wunderschönen, aber echt langen Ost-West-Durchquerung von Kanada, erreichen wir Banff und damit den ersten der beiden, so hochgejubelten Nationalparks in Alberta. Was haben wir im Vorfeld darüber gelesen, farbenfrohe Bilder im Fernsehen gesehen und was haben uns die unterwegs getroffenen Kanadier davon vorgeschwärmt. Erst einmal bekommen wir nur den einen Eindruck:  Wintereinbruch! Es schüttet wie aus Kübeln, der Nebel hängt bis ins Tal, von der sicher wunderbaren Szenerie der Rocky Mountains sehen wir nur ab und zu ein paar Ausschnitte zwischen den Wolkenfetzen. Was soll’s, wir dürfen uns echt nicht beschweren, bis jetzt hatten wir ja auf unserer Reise wirklich fast durchgehend nur Sonnenschein. Wir fahren also nach Banff, was als einer der sehenswertesten Orte in Kanada gilt, angeblich gebaut nach dem Vorbild europäischer Skiorte. Na ja, ob man diese unvorstellbare Ansammlung von Souvenirshops und Fast-Food-Lokalen dann wirklich gesehen haben muss, darüber kann man diskutieren, wir halten das für ziemlich verzichtbar. Was uns dann den Tag rettet, ist allerdings das wirklich großartige und sehenswerte „Fairmont-Banff-Springs-Hotel“.
Wintereinbruch! Es schüttet wie aus Kübeln, der Nebel hängt bis ins Tal, von der sicher wunderbaren Szenerie der Rocky Mountains sehen wir nur ab und zu ein paar Ausschnitte zwischen den Wolkenfetzen. Was soll’s, wir dürfen uns echt nicht beschweren, bis jetzt hatten wir ja auf unserer Reise wirklich fast durchgehend nur Sonnenschein. Wir fahren also nach Banff, was als einer der sehenswertesten Orte in Kanada gilt, angeblich gebaut nach dem Vorbild europäischer Skiorte. Na ja, ob man diese unvorstellbare Ansammlung von Souvenirshops und Fast-Food-Lokalen dann wirklich gesehen haben muss, darüber kann man diskutieren, wir halten das für ziemlich verzichtbar. Was uns dann den Tag rettet, ist allerdings das wirklich großartige und sehenswerte „Fairmont-Banff-Springs-Hotel“. Eine Luxusherberge der Superlative, Doppelzimmer ab 900 Dollar pro Nacht! Egal, wohnen wollen wir dort eh nicht, aber ein paar Drinks und ein Snack in einer der wunderschönen Bars und ein Foto von der einzigartigen Terrasse, das muss auf jeden Fall sein. Das Hotel wurde von den Eigentümern der Canadian Pacific Railway nach Fertigstellung der Ost-West-
Eine Luxusherberge der Superlative, Doppelzimmer ab 900 Dollar pro Nacht! Egal, wohnen wollen wir dort eh nicht, aber ein paar Drinks und ein Snack in einer der wunderschönen Bars und ein Foto von der einzigartigen Terrasse, das muss auf jeden Fall sein. Das Hotel wurde von den Eigentümern der Canadian Pacific Railway nach Fertigstellung der Ost-West- Eisenbahnlinie im Jahr 1887 als Luxusherberge für betuchte Reisende, die den Westen erkunden wollten, gebaut und hat bis heute absolut nichts von seinem exklusiven Charme eingebüßt. Witziges Detail am Rande: Beim Bau der Luxusherberge unterlief dem Baumeister ein Fehler, der Bauplan wurde um 180 Grad verkehrt umgesetzt, sodass den „Million dollar view“,
Eisenbahnlinie im Jahr 1887 als Luxusherberge für betuchte Reisende, die den Westen erkunden wollten, gebaut und hat bis heute absolut nichts von seinem exklusiven Charme eingebüßt. Witziges Detail am Rande: Beim Bau der Luxusherberge unterlief dem Baumeister ein Fehler, der Bauplan wurde um 180 Grad verkehrt umgesetzt, sodass den „Million dollar view“, die wunderschöne Aussicht über den Bow River, von Anfang an nicht die Gäste der luxuriösen Suiten genossen, sondern das Küchenpersonal… , so kann’s gehen!
die wunderschöne Aussicht über den Bow River, von Anfang an nicht die Gäste der luxuriösen Suiten genossen, sondern das Küchenpersonal… , so kann’s gehen!
Der Starkregen lässt einfach nicht nach, die Bezirksverwaltung von Calgary ruft den Notstand aus, in den  Rocky Mountains schneit es, viele Pässe in den Norden sind gesperrt, wir sitzen erst mal fest. In den Nationalparks von Banff und Jasper ist das Campen nur auf ausgewiesenen Campgrounds erlaubt, was für uns an sich schon eine Herausforderung darstellt. Rund um unseren Campground sichert ein Elektrozaun die Gäste vor den „Gefahren der Wildnis“, sprich Bären, Wölfen, Pumas,… .
Rocky Mountains schneit es, viele Pässe in den Norden sind gesperrt, wir sitzen erst mal fest. In den Nationalparks von Banff und Jasper ist das Campen nur auf ausgewiesenen Campgrounds erlaubt, was für uns an sich schon eine Herausforderung darstellt. Rund um unseren Campground sichert ein Elektrozaun die Gäste vor den „Gefahren der Wildnis“, sprich Bären, Wölfen, Pumas,… .  Überall sind Warntafeln aufgestellt, wir kommen uns vor wie im Gefängnis – Nein, so haben wir uns Kanada ganz sicher nicht vorgestellt! Da der Wetterbericht keinerlei Besserung verspricht, fahren wir weiter Richtung Jasper Nationalpark, nicht auslassen wollen wir dabei den Besuch des angeblich „meistbesuchtesten Bergsees der Welt“ – des Lake Louise. Hier geht die Nationalpark-Massenabfertigung weiter – und uns inzwischen gewaltig auf die Nerven. Nur im Shuttlebus gelangt man zum See, an dessen
Überall sind Warntafeln aufgestellt, wir kommen uns vor wie im Gefängnis – Nein, so haben wir uns Kanada ganz sicher nicht vorgestellt! Da der Wetterbericht keinerlei Besserung verspricht, fahren wir weiter Richtung Jasper Nationalpark, nicht auslassen wollen wir dabei den Besuch des angeblich „meistbesuchtesten Bergsees der Welt“ – des Lake Louise. Hier geht die Nationalpark-Massenabfertigung weiter – und uns inzwischen gewaltig auf die Nerven. Nur im Shuttlebus gelangt man zum See, an dessen  Ufer sich Asiatengruppen stauen. Ein riesiger Hotelkasten, das „Fairmont Hotel Lake Louise“, das weitaus nicht so schöne Schwesterhotel von Banff, dominiert als einziges Gebäude das Ufer neben dem Parkplatz. Wir flüchten über einen Wanderweg, steil nach oben, bis zu einem wunderbaren,
Ufer sich Asiatengruppen stauen. Ein riesiger Hotelkasten, das „Fairmont Hotel Lake Louise“, das weitaus nicht so schöne Schwesterhotel von Banff, dominiert als einziges Gebäude das Ufer neben dem Parkplatz. Wir flüchten über einen Wanderweg, steil nach oben, bis zu einem wunderbaren, leider aber schon ziemlich zugewachsenen, Aussichtspunkt über dem See, wo es schlagartig ruhig wird und genießen die Aussicht von oben, abseits der Massen. Wieder zurück am See werfen wir dann noch einen Blick auf die Preise für die Kanumiete und können es nicht glauben: 145 Dollar – nein, nicht pro Tag – für eine halbe Stunde!! Die Chinesen nehmen es sportlich, sind aber auch wirklich die einzigen, die sich diesen für uns wirklich verzichtbaren Luxus gönnen. Und ganz ehrlich: „Meistbesuchtester Bergsee der Welt?? – Die waren wohl alle
leider aber schon ziemlich zugewachsenen, Aussichtspunkt über dem See, wo es schlagartig ruhig wird und genießen die Aussicht von oben, abseits der Massen. Wieder zurück am See werfen wir dann noch einen Blick auf die Preise für die Kanumiete und können es nicht glauben: 145 Dollar – nein, nicht pro Tag – für eine halbe Stunde!! Die Chinesen nehmen es sportlich, sind aber auch wirklich die einzigen, die sich diesen für uns wirklich verzichtbaren Luxus gönnen. Und ganz ehrlich: „Meistbesuchtester Bergsee der Welt?? – Die waren wohl alle  noch nie bei uns am Gosausee, der hat mit seinem Dachsteingletscher aber hundertprozentig im Vergleich die Nase vorn! Fasziniert sind wir dann allerdings doch vom zweiten See, dem „Lake Moraine“, er liegt noch höher als der „Lake Louise“ und ist umrahmt von gleich zehn 3.000er Gipfeln, die sich uns durch ein kurzes Sonnenfenster sogar teilweise zeigen. Dieses Motiv, zusammen mit der leuchtend türkisen Farbe des Sees, entschädigt uns für die
noch nie bei uns am Gosausee, der hat mit seinem Dachsteingletscher aber hundertprozentig im Vergleich die Nase vorn! Fasziniert sind wir dann allerdings doch vom zweiten See, dem „Lake Moraine“, er liegt noch höher als der „Lake Louise“ und ist umrahmt von gleich zehn 3.000er Gipfeln, die sich uns durch ein kurzes Sonnenfenster sogar teilweise zeigen. Dieses Motiv, zusammen mit der leuchtend türkisen Farbe des Sees, entschädigt uns für die  auch hier vorherrschende Vermarktung. Die Zimmer in der unscheinbaren „Lake Moraine Lodge“ kosten auch ab 800 Dollar pro Nacht, warum man sich das leisten sollte erschließt sich uns nicht, außer der Lodge und natürlich einem riesigen Souvenirshop mit fotogener Bärenfigur vor der Tür gibt es dort nämlich ganz einfach …nichts.
auch hier vorherrschende Vermarktung. Die Zimmer in der unscheinbaren „Lake Moraine Lodge“ kosten auch ab 800 Dollar pro Nacht, warum man sich das leisten sollte erschließt sich uns nicht, außer der Lodge und natürlich einem riesigen Souvenirshop mit fotogener Bärenfigur vor der Tür gibt es dort nämlich ganz einfach …nichts.
Irgendwie können wir uns beim besten Willen nicht ganz anfreunden mit diesem touristischen Gebiet der Nationalparks und, da das Wetter zum Wandern sowieso zu schlecht ist, entschließen wir uns, weiter Richtung Norden zu fahren. Schon nach zwei Nächten am Campingplatz reicht es uns mit der Bevormundung und wir übernachten ab diesem Zeitpunkt wieder freistehend, gleich einmal am 2.100 m hohen Sumwapta Pass, bei kuscheligen 4 Grad. Am nächsten Morgen freut sich der Unimog so gar nicht über das Starten, braucht zum ersten Mal ein paar Versuche und nebelt die ganze Gegend mit Qualm ein. Hmmm, wenn er sich damit jetzt schon schwertut, wie wird das dann erst in den Anden in Südamerika werden, denken wir kurz – Aber bis dahin rinnt ja noch jede Menge Schneewasser die Rocky
Schon nach zwei Nächten am Campingplatz reicht es uns mit der Bevormundung und wir übernachten ab diesem Zeitpunkt wieder freistehend, gleich einmal am 2.100 m hohen Sumwapta Pass, bei kuscheligen 4 Grad. Am nächsten Morgen freut sich der Unimog so gar nicht über das Starten, braucht zum ersten Mal ein paar Versuche und nebelt die ganze Gegend mit Qualm ein. Hmmm, wenn er sich damit jetzt schon schwertut, wie wird das dann erst in den Anden in Südamerika werden, denken wir kurz – Aber bis dahin rinnt ja noch jede Menge Schneewasser die Rocky  Mountains hinunter,…. . Wir folgen dem „Icefield Parkway“ nach Norden, die Sicht auf die Gipfel der Rockys bleibt weiterhin meistens getrübt, zum Abschluss versöhnt uns aber ein Besuch des „Columbia Icefields“ mit dem – für uns – insgesamt eher bescheiden gebliebenen Nationalparkerlebnis. Auf den Gletscher steigen wir, entgegen aller
Mountains hinunter,…. . Wir folgen dem „Icefield Parkway“ nach Norden, die Sicht auf die Gipfel der Rockys bleibt weiterhin meistens getrübt, zum Abschluss versöhnt uns aber ein Besuch des „Columbia Icefields“ mit dem – für uns – insgesamt eher bescheiden gebliebenen Nationalparkerlebnis. Auf den Gletscher steigen wir, entgegen aller  Vorschriften, alleine und übersehen geflissentlich alle Tafeln mit „Guided groups only“. Wir steigen selbstständig bis ca. zur Hälfte des Eisfeldes hinauf und beobachten dabei die armen Gruppentouristen, die für viel Geld mit Bussen bis hinauf gekarrt werden und dann oben kurz am Gletscher spazieren gehen dürfen, bevor sie wieder mit dem Bus nach unten fahren müssen. Die grandiosen Wasserfälle der „Athabasca Falls“ bilden einen würdigen Abschluss, bevor wir den Nationalparks endgültig den Rücken kehren.
Vorschriften, alleine und übersehen geflissentlich alle Tafeln mit „Guided groups only“. Wir steigen selbstständig bis ca. zur Hälfte des Eisfeldes hinauf und beobachten dabei die armen Gruppentouristen, die für viel Geld mit Bussen bis hinauf gekarrt werden und dann oben kurz am Gletscher spazieren gehen dürfen, bevor sie wieder mit dem Bus nach unten fahren müssen. Die grandiosen Wasserfälle der „Athabasca Falls“ bilden einen würdigen Abschluss, bevor wir den Nationalparks endgültig den Rücken kehren.
Hinter Jasper nehmen wir den „Big Horn Highway“, dieser ist zwar ebenfalls durchgehend asphaltiert, aber doch etwas einsamer als die Hauptroute nach Norden, was wir, nach den Touristengebieten, besonders schätzen. Zur Bezeichnung „Highway“ sei gesagt, dass damit hierzulande alles benannt wird, worauf Fahrzeuge fahren können, egal ob asphaltiert und vierspurig oder ob Schotter- und Schlammpiste. Über die Beschaffenheit und den momentanen Zustand muss man sich immer selbst vor dem Befahren erkundigen. Wundert Euch nicht, dass hier noch viele Highways namentlich genannt werden, dies dient eigentlich nur uns für sp äter, zur besseren Erinnerung an die gefahrene Strecke. An seinem Endpunkt, in „Grande Prairie“, habe ich eine besondere Verabredung: Was braucht Frau nach zwei Monaten Reise unbedingt? Richtig: Friseur, Nagelstudio und Pedicure – Ist doch klar Mädels, oder? Nachdem ich das schon eine Zeit lang zur Sprache bringe, für Karl die Wichtigkeit dazu auf einer Skala von 0 bis 10 aber höchstens bei 1 steht, nehme ich die Umsetzung selbst in die Hand und buche kurzerhand online einen Termin in der nächsten Stadt. Wir müssen also dort stoppen und die hübsche und wirklich kompetente Alanis verpasst meinen Haaren im Friseursalon die dringend benötigten Strähnen. Nebenbei erzählt sie mir in den drei Stunden die ich bei
äter, zur besseren Erinnerung an die gefahrene Strecke. An seinem Endpunkt, in „Grande Prairie“, habe ich eine besondere Verabredung: Was braucht Frau nach zwei Monaten Reise unbedingt? Richtig: Friseur, Nagelstudio und Pedicure – Ist doch klar Mädels, oder? Nachdem ich das schon eine Zeit lang zur Sprache bringe, für Karl die Wichtigkeit dazu auf einer Skala von 0 bis 10 aber höchstens bei 1 steht, nehme ich die Umsetzung selbst in die Hand und buche kurzerhand online einen Termin in der nächsten Stadt. Wir müssen also dort stoppen und die hübsche und wirklich kompetente Alanis verpasst meinen Haaren im Friseursalon die dringend benötigten Strähnen. Nebenbei erzählt sie mir in den drei Stunden die ich bei ihr verbringe, auch noch ihre Lebensgeschichte und die ihres Freundes, sodass ich dann fast ein bisschen froh bin, dass sich die liebenswürdige, vietnamesische Dame im Nagelstudio schweigend meinen Händen und Füßen widmet. So runderneuert und glücklich kehre ich zum Unimog zurück, um dort zu erfahren, dass Karl in der Zwischenzeit wieder mal mit einem neuen, kleinen Ölproblem in einer Werkstatt war. Eine Dichtung zwischen Vorgelege und Achse, wieder mal vorne links, ist etwas undicht. Die Werkstatt hat aber keine geeignete Dichtung lagernd, das Ganze ist aber, zumindestens im Moment, auch noch nicht wirklich ein akutes Problem, wir müssen es halt beobachten und gegebenenfalls Öl nachfüllen bzw. hoffen, dass es auf den bevorstehenden Holperpisten, mit denen wir in Alaska durchaus rechnen, nicht schlimmer wird. Auf dem Weg nach Süden wollen wir dann sowieso bei einer Unimog-Werkstätte in der Nähe von Vancouver zum Service vorbeifahren, bis dorthin sollte die Dichtung bitte noch halbwegs halten.
ihr verbringe, auch noch ihre Lebensgeschichte und die ihres Freundes, sodass ich dann fast ein bisschen froh bin, dass sich die liebenswürdige, vietnamesische Dame im Nagelstudio schweigend meinen Händen und Füßen widmet. So runderneuert und glücklich kehre ich zum Unimog zurück, um dort zu erfahren, dass Karl in der Zwischenzeit wieder mal mit einem neuen, kleinen Ölproblem in einer Werkstatt war. Eine Dichtung zwischen Vorgelege und Achse, wieder mal vorne links, ist etwas undicht. Die Werkstatt hat aber keine geeignete Dichtung lagernd, das Ganze ist aber, zumindestens im Moment, auch noch nicht wirklich ein akutes Problem, wir müssen es halt beobachten und gegebenenfalls Öl nachfüllen bzw. hoffen, dass es auf den bevorstehenden Holperpisten, mit denen wir in Alaska durchaus rechnen, nicht schlimmer wird. Auf dem Weg nach Süden wollen wir dann sowieso bei einer Unimog-Werkstätte in der Nähe von Vancouver zum Service vorbeifahren, bis dorthin sollte die Dichtung bitte noch halbwegs halten.
Wir verlassen die Provinz Alberta und erreichen British Columbia. Das Wetter bessert sich langsam, Sonne und Regen wechseln sich ab. Wieder einmal habe ich auf Google Maps eine „Boat Launch“ ausfindig gemacht. Fast an jedem größeren See gibt es das, dort können die Leute ihre Boote von ihren Trailern  ins Wasser lassen, meistens schließt sich daran eine wunderbare Picknick-Area mit Tischen und Feuerstellen an, natürlich offiziell immer nur zum „Day use“, also nicht zum Übernachten, aber diese Tafeln regen uns schon lange nicht mehr auf… . Wir steigen aus und erkunden die Umgebung des „Swan Lake“. Es ist einer dieser traumhaften Plätze, die man nur durch Zufall findet. An diesem windstillen und ausnahmsweise, trotz des Sees, moskitofreien Abend, kochen wir und sitzen später mit einer Flasche Wein noch draußen. Vom nebenan gelegenen Campingplatz spazieren immer wieder Leute vorbei. Ein Paar steuert direkt auf uns zu und fragt auf englisch ob es uns etwas ausmacht, wenn sie „einfach so bei uns hereinschneien“ würden? Natürlich macht es uns absolut nichts aus – Ganz im Gegenteil! Ciko und seine Frau erweisen sich als ein sehr lustiges, kanadisches Paar, das eigentlich gar nicht so weit entfernt an einem See zu Hause ist. Sie haben einfach mal ihr Kanu und ihr Zelt eingepackt und sind übers Wochenende an einen anderen See gefahren. Jeder von den beiden zieht dann eine, wie es sich für gut erzogene Kanadier gehört, versteckt bis zu uns transportierte, Dose Bier aus der Jackentasche, Ciko lädt uns zusätzlich noch ein, seine spezielle Rauchware mit ihm zu teilen und der Abend wird sehr lustig. Er ist ein passionierter Jäger und Fischer, die beiden zeigen uns Fotos und Videos, wie ein Luchs im Winter auf die Terrasse ihres Hauses kommt und ganz in Ruhe das dort gelagerte Fleisch frisst – Unglaublich! Wie das halt so ist an solchen Abenden, je weiter sie fortschreiten, desto leichter redet es sich und irgendwann lasse ich durchklingen, dass ich gerne mal das Fischen probieren würde. Na, mehr hat Ciko nicht gebraucht und er bietet sich sofort an, mir am nächsten Tag meine erste Fischerstunde zu geben. Wir verabreden uns für „ziemlich in der Früh“, er ist ein Frühaufsteher und ich sage voller Euphorie natürlich sofort zu. Am nächsten Morgen hebe ich um 06.30 Uhr mal probeweise, kurz und leicht schmerzhaft den Kopf, höre dass – Gott sei Dank – der Regen auf unsere Dachluke prasselt, drehe mich auf die andere Seite und schlafe weiter.
ins Wasser lassen, meistens schließt sich daran eine wunderbare Picknick-Area mit Tischen und Feuerstellen an, natürlich offiziell immer nur zum „Day use“, also nicht zum Übernachten, aber diese Tafeln regen uns schon lange nicht mehr auf… . Wir steigen aus und erkunden die Umgebung des „Swan Lake“. Es ist einer dieser traumhaften Plätze, die man nur durch Zufall findet. An diesem windstillen und ausnahmsweise, trotz des Sees, moskitofreien Abend, kochen wir und sitzen später mit einer Flasche Wein noch draußen. Vom nebenan gelegenen Campingplatz spazieren immer wieder Leute vorbei. Ein Paar steuert direkt auf uns zu und fragt auf englisch ob es uns etwas ausmacht, wenn sie „einfach so bei uns hereinschneien“ würden? Natürlich macht es uns absolut nichts aus – Ganz im Gegenteil! Ciko und seine Frau erweisen sich als ein sehr lustiges, kanadisches Paar, das eigentlich gar nicht so weit entfernt an einem See zu Hause ist. Sie haben einfach mal ihr Kanu und ihr Zelt eingepackt und sind übers Wochenende an einen anderen See gefahren. Jeder von den beiden zieht dann eine, wie es sich für gut erzogene Kanadier gehört, versteckt bis zu uns transportierte, Dose Bier aus der Jackentasche, Ciko lädt uns zusätzlich noch ein, seine spezielle Rauchware mit ihm zu teilen und der Abend wird sehr lustig. Er ist ein passionierter Jäger und Fischer, die beiden zeigen uns Fotos und Videos, wie ein Luchs im Winter auf die Terrasse ihres Hauses kommt und ganz in Ruhe das dort gelagerte Fleisch frisst – Unglaublich! Wie das halt so ist an solchen Abenden, je weiter sie fortschreiten, desto leichter redet es sich und irgendwann lasse ich durchklingen, dass ich gerne mal das Fischen probieren würde. Na, mehr hat Ciko nicht gebraucht und er bietet sich sofort an, mir am nächsten Tag meine erste Fischerstunde zu geben. Wir verabreden uns für „ziemlich in der Früh“, er ist ein Frühaufsteher und ich sage voller Euphorie natürlich sofort zu. Am nächsten Morgen hebe ich um 06.30 Uhr mal probeweise, kurz und leicht schmerzhaft den Kopf, höre dass – Gott sei Dank – der Regen auf unsere Dachluke prasselt, drehe mich auf die andere Seite und schlafe weiter.  Kein Mensch geht doch bei so einem Wetter fischen, oder? Nach 09.00 Uhr stehe ich, mit inzwischen doch leicht schlechtem Gewissen, auf, ziehe meine Gummistiefel und meine Regenjacke an und mache mich auf die Suche nach Ciko. Ich finde ihn – wie kann es anders sein – am See mit seinem gesamten Angelequipment. Ich überlege mir eine brauchbare Ausrede für mein Verschlafen und sage ihm, dass ich nicht gedacht hätte, dass man an einem so verregneten Tag Fische fangen
Kein Mensch geht doch bei so einem Wetter fischen, oder? Nach 09.00 Uhr stehe ich, mit inzwischen doch leicht schlechtem Gewissen, auf, ziehe meine Gummistiefel und meine Regenjacke an und mache mich auf die Suche nach Ciko. Ich finde ihn – wie kann es anders sein – am See mit seinem gesamten Angelequipment. Ich überlege mir eine brauchbare Ausrede für mein Verschlafen und sage ihm, dass ich nicht gedacht hätte, dass man an einem so verregneten Tag Fische fangen  könnte. Er schaut mich nur kurz strafend an und meint: „Den Fischen ist das Wetter egal, die
könnte. Er schaut mich nur kurz strafend an und meint: „Den Fischen ist das Wetter egal, die sind eh schon nass“,…. , Aha, ok, na ja, wo er recht hat, hat er recht, muss ich leicht zerknirscht zugeben. Er ist aber gleich wieder guter Laune und zeigt mir dann noch den riesigen Fisch den er heute um 08.00 Uhr, leider ohne mich, gefangen hat. Trotz allem erhalte ich dann von ihm noch die allererste Fischerstunde meines Lebens. Ich bin ziemlich sicher, dass ich die
sind eh schon nass“,…. , Aha, ok, na ja, wo er recht hat, hat er recht, muss ich leicht zerknirscht zugeben. Er ist aber gleich wieder guter Laune und zeigt mir dann noch den riesigen Fisch den er heute um 08.00 Uhr, leider ohne mich, gefangen hat. Trotz allem erhalte ich dann von ihm noch die allererste Fischerstunde meines Lebens. Ich bin ziemlich sicher, dass ich die  Videos, die er dabei von mir gemacht hat, niemals an die Öffentlichkeit geben werde, sorry Leute, das ist echt peinlich und gefangen habe ich natürlich auch nichts. Das Ganze schaut viel, viel einfacher aus als es ist. Ciko beweist eine Engelsgeduld und zeigt mir noch genau, welche Angelrute, Haken, Köder, etc sinnvoll wären, falls ich mir wirklich eine Fischerausrüstung zulegen sollte. Reizen würde es mich schon, die Frage ist wieder einmal nur: Wo soll ich die nur unterbringen im Unimog? – Schau ma mal… .
Videos, die er dabei von mir gemacht hat, niemals an die Öffentlichkeit geben werde, sorry Leute, das ist echt peinlich und gefangen habe ich natürlich auch nichts. Das Ganze schaut viel, viel einfacher aus als es ist. Ciko beweist eine Engelsgeduld und zeigt mir noch genau, welche Angelrute, Haken, Köder, etc sinnvoll wären, falls ich mir wirklich eine Fischerausrüstung zulegen sollte. Reizen würde es mich schon, die Frage ist wieder einmal nur: Wo soll ich die nur unterbringen im Unimog? – Schau ma mal… .
„Das Kreuz mit der Reisekasse“ – und „Das Kanada unserer Träume…“
Unsere Reisekasse folgt ja „eigentlich“ einem Plan. Wir haben uns vorgenommen, durchschnittlich (also auf die teuren und billigen Länder gerechnet) auf der ganzen Reise ca. € 50,00 pro Tag auszugeben, ausgenommen das Tanken und Reparaturen am Auto. Das inkludiert Campingplätze, die wir aber sowieso nach Möglichkeit meiden, essen gehen, Einkäufe, Souvenirs, Eintritte, etc. Ah ja – und da wäre natürlich dann noch die Sache mit dem „Liquor Store“. In Kanada und den USA gibt es Alkohol ja nicht im Supermarkt zu kaufen, sondern eben in eigenen Liquor Stores. Ihr müsst Euch so einen Einkaufstag dann ungefähr so vorstellen: Auf einer Strecke von ca. 700 km durch die kanadische Einsamkeit taucht einer der wenigen Orte mit Einkaufsmöglichkeit vor uns auf. Die Konversation beginnt so: Karl: „Was kochen wir heute?“ Ich: Wir haben noch jede Menge Reste, entweder kalt oder Gröstl würde sich anbieten, Spaghetti haben wir auch noch“. Karl: „Passt, dann brauchen wir ja nix einkaufen“. Ich, nach einer strategischen Pause: „Mhmm, aber Bier ist nicht mehr viel da“…, Karl: „Kann ja gar nicht sein, wir haben doch letztens gerade 36 Dosen gekauft“; Ich: Erstens war das schon vor 14 Tagen, zweitens waren es nur 24, weil Du gesagt hast, das ist genug, und… – Ich habe die sicher nicht alleine getrunken, ich trinke meistens meine Cider“ (zur Erklärung: Da Prosecco in Kanada nur in Flaschen und wirklich unverschämt teuer verkauft wird, bin ich auf Apfel- und Mango-Cider-Dosen umgestiegen, die wirklich super schmecken). Karl: „Na ja, dann kaufen wir halt ein paar Dosen Bier, kein Problem“. Im Liqouor Store geht es dann weiter: Karl:  „24 oder 36 Dosen Bier?“; Ich: „Nimm 36, wer weiß, wann wir wieder wo vorbeikommen und Cider Dosen nehm‘ ich auch gleich ein paar mit – und haben wir eigentlich noch Wein?“ Karl verschwindet zwischen den Wein-Regalen. „Da gibt’s einen günstigen Chardonnay, soll ich den nehmen?“ Ich: „Ja, klar, ich hab‘ hier noch einen Rosé gefunden und einen Merlot im Angebot, den nehmen wir auch noch dazu“. Passt, Einkauf beendet. Kurz vor der Kassa steht dann der „Last chance sale“-Korb, in dem sich doch glatt eine Flasche unglaublich günstiger, italienischer Rosé Prosecco findet und Karl stellt ohne Worte noch eine Flasche karibischen Rum dazu. An der Kasse flötet die Kassierin mit unwiderstehlichem Lächeln: „The total is CAN$ 182,00, thank you very much for joining our shop today“,…. – Ah ja eh, wir freuen uns auch sehr – Und überhaupt: Wir haben heute beim Essen voll eingespart, ist ja auch schon was, oder,…??
„24 oder 36 Dosen Bier?“; Ich: „Nimm 36, wer weiß, wann wir wieder wo vorbeikommen und Cider Dosen nehm‘ ich auch gleich ein paar mit – und haben wir eigentlich noch Wein?“ Karl verschwindet zwischen den Wein-Regalen. „Da gibt’s einen günstigen Chardonnay, soll ich den nehmen?“ Ich: „Ja, klar, ich hab‘ hier noch einen Rosé gefunden und einen Merlot im Angebot, den nehmen wir auch noch dazu“. Passt, Einkauf beendet. Kurz vor der Kassa steht dann der „Last chance sale“-Korb, in dem sich doch glatt eine Flasche unglaublich günstiger, italienischer Rosé Prosecco findet und Karl stellt ohne Worte noch eine Flasche karibischen Rum dazu. An der Kasse flötet die Kassierin mit unwiderstehlichem Lächeln: „The total is CAN$ 182,00, thank you very much for joining our shop today“,…. – Ah ja eh, wir freuen uns auch sehr – Und überhaupt: Wir haben heute beim Essen voll eingespart, ist ja auch schon was, oder,…??
Wir erreichen Dawson Creek und somit einen wichtigen Abschnitt, nämlich den Beginn des insgesamt 2.220 km langen  „Alaska Highways“, der 1942 von 11.000 amerikanischen Soldaten in nur sechs (!) Monaten Bauzeit fertiggestellt wurde. Wir folgen ihm durch dichte Waldgebiete, bei durchschnittlichem Wetter und Temperaturen zwischen 04.00 und 15.00 Grad. Wir fahren einfach und wenn wir müde werden, biegen wir auf „Gut Glück“ in Stichstraßen hinein und suchen uns Übernachtungsplätze mitten im Wald in der völligen Einsamkeit. Genau das haben wir auch vor, als plötzlich vor uns das Schild „Buffalo Inn“ auftaucht. Direkt neben der Straße sehen wir eine Art Wirtshaus auf einem LKW-Parkplatz und dazu ein in Neonrot leuchtendes „Pub“-Schild, das uns natürlich sofort magisch anzieht. Es hat wieder einmal stark geregnet und der ganze Parkplatz
„Alaska Highways“, der 1942 von 11.000 amerikanischen Soldaten in nur sechs (!) Monaten Bauzeit fertiggestellt wurde. Wir folgen ihm durch dichte Waldgebiete, bei durchschnittlichem Wetter und Temperaturen zwischen 04.00 und 15.00 Grad. Wir fahren einfach und wenn wir müde werden, biegen wir auf „Gut Glück“ in Stichstraßen hinein und suchen uns Übernachtungsplätze mitten im Wald in der völligen Einsamkeit. Genau das haben wir auch vor, als plötzlich vor uns das Schild „Buffalo Inn“ auftaucht. Direkt neben der Straße sehen wir eine Art Wirtshaus auf einem LKW-Parkplatz und dazu ein in Neonrot leuchtendes „Pub“-Schild, das uns natürlich sofort magisch anzieht. Es hat wieder einmal stark geregnet und der ganze Parkplatz versinkt mehr oder weniger im Schlamm. Wir betreten den Vorraum des Lokals und gleich erwartet uns ein großes Schild „No muddy boots“ und ein großes Schuhregal an der Wand, an dem die ganzen Arbeiter, die auf den vielen Baustellen entlang des Alaska Highways arbeiten und auch die Trucker brav ihre dreckigen Schuhe ausziehen. Alle sitzen dann in Socken im
versinkt mehr oder weniger im Schlamm. Wir betreten den Vorraum des Lokals und gleich erwartet uns ein großes Schild „No muddy boots“ und ein großes Schuhregal an der Wand, an dem die ganzen Arbeiter, die auf den vielen Baustellen entlang des Alaska Highways arbeiten und auch die Trucker brav ihre dreckigen Schuhe ausziehen. Alle sitzen dann in Socken im  Lokal. Wir sind so ziemlich die einzigen mit (allerdings wirklich fast sauberen) Schuhen und suchen uns einen freien Tisch mitten unter den Arbeitern. Die Kellnerin ist, wie überall, wieder mal super freundlich und versorgt uns gleich mit kostenlosem Wasser (Alkohol gibt es hier nicht) und der Tageskarte und wir fühlen uns so richtig wohl im touristenfreien Raum. Da wir die Tagessuppe im schnell gesprochenen Englisch nicht gleich kapieren, bingt sie uns sofort eine Kostprobe einer wunderbaren Erbsensuppe mit Speck, die wir natürlich umgehend bestellen und wegputzen. Karl bekommt danach einen Burger, ich entscheide mich für Roastbeef vom „Moose“. Das ist die größte, lebende Elchgattung der Welt, sie kommt in Kanada und Alaska vor, die Moose-Bullen bringen bis zu 750 kg auf die Waage. Wir wurden bereits gewarnt auf keinen Fall auszusteigen, sollte ein Moose unseren Weg kreuzen, da sie, insbesonders wenn sie Kälber dabei haben, wirklich aggressiv sein sollen. Wir haben aber erst einmal eines gesehen, das relativ schnell vor uns über die Straße gelaufen ist. Ich bin also neugierig auf das Roastbeef, das sich dann zwar als wirklich ausgezeichnet und dazu noch als perfekt rosa gebraten erweist, leider stopfen die Kanadier, warum auch immer – es ist ein Graus, dieses wunderbare Fleisch wieder einmal mit Sauce und Salatblatt zwischen zwei Brotscheiben und man muss das ganze erst einmal auseinandernehmen um die einzelnen Bestandteile dann halbwegs schmecken zu können. Das mit Neonschrift angepriesene Pub hat dann leider geschlossen und wir beenden den Abend mit einem Drink in den eigenen vier Wänden, kein Problem, wir haben ja seit heute Vormittag die große Auswahl,… .
Lokal. Wir sind so ziemlich die einzigen mit (allerdings wirklich fast sauberen) Schuhen und suchen uns einen freien Tisch mitten unter den Arbeitern. Die Kellnerin ist, wie überall, wieder mal super freundlich und versorgt uns gleich mit kostenlosem Wasser (Alkohol gibt es hier nicht) und der Tageskarte und wir fühlen uns so richtig wohl im touristenfreien Raum. Da wir die Tagessuppe im schnell gesprochenen Englisch nicht gleich kapieren, bingt sie uns sofort eine Kostprobe einer wunderbaren Erbsensuppe mit Speck, die wir natürlich umgehend bestellen und wegputzen. Karl bekommt danach einen Burger, ich entscheide mich für Roastbeef vom „Moose“. Das ist die größte, lebende Elchgattung der Welt, sie kommt in Kanada und Alaska vor, die Moose-Bullen bringen bis zu 750 kg auf die Waage. Wir wurden bereits gewarnt auf keinen Fall auszusteigen, sollte ein Moose unseren Weg kreuzen, da sie, insbesonders wenn sie Kälber dabei haben, wirklich aggressiv sein sollen. Wir haben aber erst einmal eines gesehen, das relativ schnell vor uns über die Straße gelaufen ist. Ich bin also neugierig auf das Roastbeef, das sich dann zwar als wirklich ausgezeichnet und dazu noch als perfekt rosa gebraten erweist, leider stopfen die Kanadier, warum auch immer – es ist ein Graus, dieses wunderbare Fleisch wieder einmal mit Sauce und Salatblatt zwischen zwei Brotscheiben und man muss das ganze erst einmal auseinandernehmen um die einzelnen Bestandteile dann halbwegs schmecken zu können. Das mit Neonschrift angepriesene Pub hat dann leider geschlossen und wir beenden den Abend mit einem Drink in den eigenen vier Wänden, kein Problem, wir haben ja seit heute Vormittag die große Auswahl,… .
Der nächste Tag verwöhnt uns mit mittlerweile ungewohntem Sonnenschein und wir erreichen Fort Nelson, einen ehemaligen Außenhandelsposten der „North West Company . Die heute ca. 4.200 Einwohner leben inzwischen überwiegend von der Wirtschaft die sich rund um Gas, Öl und Holz gebildet hat. Als wir im Supermarkt diesmal unsere Lebensmittelvorräte auffüllen, werden wir von Einheimischen, die wieder mal unseren Unimog bewundern,  sehr nachdrücklich gewarnt, dass wir uns hier in der Gegend wirklich vor Bären in Acht nehmen sollen und keinesfalls auf Übernachtungsplätzen die Tür zur Wohnkabine offen lassen sollen, weder am Tag und natürlich schon gar nicht in der Nacht, was wir aber ohnedies nicht vorhaben. Wir haben bereits in den Nationalparks und auch später immer wieder sporadisch mal Schwarzbären neben der Straße gesehen. Ab Fort Nelson wird einer der schönsten Abschnitte des Alaska Highways angekündigt und wir sind schon sehr gespannt.
sehr nachdrücklich gewarnt, dass wir uns hier in der Gegend wirklich vor Bären in Acht nehmen sollen und keinesfalls auf Übernachtungsplätzen die Tür zur Wohnkabine offen lassen sollen, weder am Tag und natürlich schon gar nicht in der Nacht, was wir aber ohnedies nicht vorhaben. Wir haben bereits in den Nationalparks und auch später immer wieder sporadisch mal Schwarzbären neben der Straße gesehen. Ab Fort Nelson wird einer der schönsten Abschnitte des Alaska Highways angekündigt und wir sind schon sehr gespannt.
Wir haben inzwischen „Rocky Mountains Regular Time“, das heißt, wir haben wieder eine Stunde gewonnen, der Zeitunterschied zu Österreich beträgt jetzt neun Stunden und wir erreichen unseren nächsten Stopp am „Summit Pass“, direkt am Ufer des wunderbaren „Summit Lakes“.
„Summit Lakes“. Es hat wieder den halben Tag geregnet und wir sind daher umso mehr erfreut, dass sich der nächste Morgen mit einem riesigen Sonnenfenster präsentiert. Wir ziehen sofort unsere Bergschuhe an, besteigen den 2.014 m hohen „Summit Peak“ und genießen den sich uns bietenden, grandiosen Panoramablick über die Ausläufer der Rocky
Es hat wieder den halben Tag geregnet und wir sind daher umso mehr erfreut, dass sich der nächste Morgen mit einem riesigen Sonnenfenster präsentiert. Wir ziehen sofort unsere Bergschuhe an, besteigen den 2.014 m hohen „Summit Peak“ und genießen den sich uns bietenden, grandiosen Panoramablick über die Ausläufer der Rocky Mountains. Schon am Beginn des Trails warnen uns Tafeln vor Bären und ich stecke lieber meinen Bärenspray ein. Nachdem ich den Einheimischen vor kurzem meinen Mini-Pfefferspray gezeigt habe und die dazu gemeint haben, jeder Bär würde sich bei dessen Anblick allerhöchstens die Lachtränen aus den Augen wischen, haben wir aufgerüstet und uns einen echten Bärenspray gekauft. Es heißt ja hier: „Black – Attack, Brown – Go down“. Soll heißen: Steht man einem Schwarzbären gegenüber und man hat keine Möglichkeit mehr sich zurückzuziehen, was bei jeder Bärenbegegnung ja immer die erste und beste Option ist, soll man versuchen ihn mit Lärm zu verjagen, bei einem Grizzly kann man das aber gleich vergessen und es wird empfohlen, sich im Notfall als allerletzten Ausweg, auf den Boden zu legen und tot zu stellen – Ob dazu im Ernstfall wirklich jemand die Nerven hat – Wir glauben es nicht wirklich und ich hoffe sehr, dass ich auch meinen Spray niemals brauchen werde.
Mountains. Schon am Beginn des Trails warnen uns Tafeln vor Bären und ich stecke lieber meinen Bärenspray ein. Nachdem ich den Einheimischen vor kurzem meinen Mini-Pfefferspray gezeigt habe und die dazu gemeint haben, jeder Bär würde sich bei dessen Anblick allerhöchstens die Lachtränen aus den Augen wischen, haben wir aufgerüstet und uns einen echten Bärenspray gekauft. Es heißt ja hier: „Black – Attack, Brown – Go down“. Soll heißen: Steht man einem Schwarzbären gegenüber und man hat keine Möglichkeit mehr sich zurückzuziehen, was bei jeder Bärenbegegnung ja immer die erste und beste Option ist, soll man versuchen ihn mit Lärm zu verjagen, bei einem Grizzly kann man das aber gleich vergessen und es wird empfohlen, sich im Notfall als allerletzten Ausweg, auf den Boden zu legen und tot zu stellen – Ob dazu im Ernstfall wirklich jemand die Nerven hat – Wir glauben es nicht wirklich und ich hoffe sehr, dass ich auch meinen Spray niemals brauchen werde.
Tatsächlich erleben wir auf dem kommenden Abschnitt des „Alaska-Highways“ dann laufend  grandiose
grandiose  Eindrücke. Wir passieren den jadefarbenen „Muncho-Lake“, sehen Herden von Waldbüffeln direkt neben der Straße und
Eindrücke. Wir passieren den jadefarbenen „Muncho-Lake“, sehen Herden von Waldbüffeln direkt neben der Straße und  stoppen auf ein heißes Bad bei den „Liard River Hot Springs“. Hier haben wir gleich doppelten Grund zum Feiern: Es ist der 21. Juni, somit Sonnenwende und wir haben heute die 10.000 km Marke unserer Reise überfahren. Nachdem wir die heißen Quellen inmitten ihrer großartigen, tropischen Vegetation genossen haben, entzünden wir daher ein
stoppen auf ein heißes Bad bei den „Liard River Hot Springs“. Hier haben wir gleich doppelten Grund zum Feiern: Es ist der 21. Juni, somit Sonnenwende und wir haben heute die 10.000 km Marke unserer Reise überfahren. Nachdem wir die heißen Quellen inmitten ihrer großartigen, tropischen Vegetation genossen haben, entzünden wir daher ein  Sonnwendfeuer und freuen uns, dass wir das in dieser einzigartigen Location feiern können. Wir resümmieren ein bisschen über das bisher Erlebte und kommen drauf, dass wir seit der Abreise nur mehr Musiksender ohne Nachrichten gehört haben und bisher noch kein einziges Mal Bedarf nach Film oder Fernsehen hatten. Wir sind sicher, sollte irgendwann irgendwas wirklich wichtiges auf der Welt passieren, wird uns jemand eine „whatsApp“ schicken – so wie 2020 im März, als wir im australischen outback nicht mitgekriegt haben, dass wegen Corona bereits die halbe Welt lahmgelegt war…. – Und anders möchten wir es ja auch gar nicht haben!
Sonnwendfeuer und freuen uns, dass wir das in dieser einzigartigen Location feiern können. Wir resümmieren ein bisschen über das bisher Erlebte und kommen drauf, dass wir seit der Abreise nur mehr Musiksender ohne Nachrichten gehört haben und bisher noch kein einziges Mal Bedarf nach Film oder Fernsehen hatten. Wir sind sicher, sollte irgendwann irgendwas wirklich wichtiges auf der Welt passieren, wird uns jemand eine „whatsApp“ schicken – so wie 2020 im März, als wir im australischen outback nicht mitgekriegt haben, dass wegen Corona bereits die halbe Welt lahmgelegt war…. – Und anders möchten wir es ja auch gar nicht haben!
Am nächsten Tag ein absolutes Highlight: Eine Schwarzbärin mit ihren Jungen
Eine Schwarzbärin mit ihren Jungen direkt neben der Straße, die sich ganz gemütlich von uns fotografieren lassen, wir sind begeistert.
direkt neben der Straße, die sich ganz gemütlich von uns fotografieren lassen, wir sind begeistert.
Mit „Watson Lake“ erreichen wir die Provinz Yukon und halten natürlich beim „Sign Post Forest“. Hier hat ein heimwehkranker Soldat während des Baus des Alaska Highways ein Schild seiner Heimatstadt aufgehängt und so hat der heutige „Schilderwald“ seinen Anfang genommen. Bad Ischl finden wir hier leider nicht,  dafür aber Gmunden und Salzburg, das ganze Gelände ist mit geschätzt 80.000 bis 100.000
dafür aber Gmunden und Salzburg, das ganze Gelände ist mit geschätzt 80.000 bis 100.000  Schildern aber so riesig, dass man unmöglich alles abgehen kann. Die
Schildern aber so riesig, dass man unmöglich alles abgehen kann. Die  Stadtverwaltung muss ständig neue bis zu 4 m hohe Pfosten aufstellen, um den Ansturm zu bewältigen. Außerdem bekommen wir hier gleich einmal einen Vorgeschmack auf die kommenden „Gravel Roads“. Ein entgegenkommendes Auto mit Wohnwagenanhänger schleudert uns mit Schwung Schotter in die Windschutzscheibe und übrig bleibt ein ca. 1 cm großer, gesplitterter Punkt in der Scheibe. „Car glass“ ist weit weg und wir hoffen halt, dass er sich nicht zu viel vergößert, bis wir wieder in der Zivilisation sind. In Watson Lake verlassen wir den „Alaska Highway“, der heute schon weitgehend begradigt und vollständig asphaltiert, keinerlei Herausforderung mehr darstellt und uns daher bald langweilt. Wir folgen dem als wirklich einsam beschriebenen „Robert Campbell Highway“, der uns über 580 km, großteils auf Schotter, weiter Richtung Norden führen soll. Es ist so, als würde man auf einer Forststraße von Bad Ischl bis nach Wiesbaden fahren, aber wir wollen weg vom Touristenverkehr und hinein in die Einsamkeit von Yukon.
Stadtverwaltung muss ständig neue bis zu 4 m hohe Pfosten aufstellen, um den Ansturm zu bewältigen. Außerdem bekommen wir hier gleich einmal einen Vorgeschmack auf die kommenden „Gravel Roads“. Ein entgegenkommendes Auto mit Wohnwagenanhänger schleudert uns mit Schwung Schotter in die Windschutzscheibe und übrig bleibt ein ca. 1 cm großer, gesplitterter Punkt in der Scheibe. „Car glass“ ist weit weg und wir hoffen halt, dass er sich nicht zu viel vergößert, bis wir wieder in der Zivilisation sind. In Watson Lake verlassen wir den „Alaska Highway“, der heute schon weitgehend begradigt und vollständig asphaltiert, keinerlei Herausforderung mehr darstellt und uns daher bald langweilt. Wir folgen dem als wirklich einsam beschriebenen „Robert Campbell Highway“, der uns über 580 km, großteils auf Schotter, weiter Richtung Norden führen soll. Es ist so, als würde man auf einer Forststraße von Bad Ischl bis nach Wiesbaden fahren, aber wir wollen weg vom Touristenverkehr und hinein in die Einsamkeit von Yukon.
Es ist kaum vorstellbar, aber schon nach ca. 100 km auf dem „Robert Campbell Highway“ fühlen wir uns  vollständig angekommen im „Kanada unserer Träume“. Hier gibt es einfach nichts mehr, es begegnen uns so gut wie keine Autos mehr, wir treffen keine Menschen, keine Warntafeln die nerven, keine Bärenschutzzäune. Man fährt nur
vollständig angekommen im „Kanada unserer Träume“. Hier gibt es einfach nichts mehr, es begegnen uns so gut wie keine Autos mehr, wir treffen keine Menschen, keine Warntafeln die nerven, keine Bärenschutzzäune. Man fährt nur  durch unendliche, kanadische Wälder. Zu den unzähligen Seen führen, wenn überhaupt, unmarkierte Stichstraßen – Hier herrscht die absolute Einsamkeit, es ist so unbeschreiblich schön, wir können es kaum glauben. Ein paar Mal sehen wir Braunbären mit Jungen neben der Straße, sie sind aber hier in der echten Wildnis, wo viel seltener Fahrzeuge vorbeikommen, um einiges scheuer als die Schwarzbären bisher und wir schaffen kein einziges Foto. Zum Übernachten fahren wir einfach links oder
durch unendliche, kanadische Wälder. Zu den unzähligen Seen führen, wenn überhaupt, unmarkierte Stichstraßen – Hier herrscht die absolute Einsamkeit, es ist so unbeschreiblich schön, wir können es kaum glauben. Ein paar Mal sehen wir Braunbären mit Jungen neben der Straße, sie sind aber hier in der echten Wildnis, wo viel seltener Fahrzeuge vorbeikommen, um einiges scheuer als die Schwarzbären bisher und wir schaffen kein einziges Foto. Zum Übernachten fahren wir einfach links oder  rechts von der Schotterstraße ab und stehen auf versteckten Waldlichtungen oder an kleinen Seen. Hier haben wir schon in der ersten Nacht ein Erlebnis, das wir ganz sicher niemals vergessen werden. Kochen in der outdoor-Küche können wir an diesem Abend vergessen, es sind einfach viel zu viele Mosquitos da, da hilft kein Einsprühen mit „Off“, da hilft gar nix, ich versuche tapfer draußen ein Bier zu trinken, muss aber nach drei Minuten aufgeben und nach drinnen flüchten. Es gibt dann Salat und, da ich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, Dressings und anderes in unsere Abwasch/Waschbecken zu leeren (ich erspare Euch hier die Details, wie ich den verklebten Abwasserschlauch durchblasen wollte und danach das ganze Badezimmer bis zur Decke putzen musste,…) leere ich den Rest vom Dressing vor die Türe (ja, sorry, ich weiß, man macht das nicht,…). Um ca. halb drei Uhr früh weckt mich ein lautes Kratzen und Schnüffeln an unserer Tür. Ich krabble zum Fußende unseres Betts und, da es hier zu dieser Jahreszeit draußen ja die ganze Nacht nicht dunkel wird, sehe ich durch das, wie immer, offene Fenster, wie ein Braunbär auf seinen Hinterbeinen dort steht wo sich normalerweise unsere Leiter befindet und an der Tür der Wohnkabine kratzt und schnüffelt. Leider bin ich bei meinem aufgeregten Versuch mein Handy zu finden und nebenbei noch Karl zu wecken, viel zu laut und bis ich wieder beim Fenster bin, hat er schon das Weite gesucht. Er bleibt dann nochmal kurz stehen und schaut zu uns herüber, als ich aber das Fliegengitter öffne, um ein Foto zu machen, verschwindet er endgültig im Gebüsch. Ob ihn wirklich der Geruch des Essigs angelockt hat oder einfach die Neugier – Keine Ahnung. Zurück bleibt für uns die Gewissheit, dass die Bären hier wirklich ganz nahe sind und man die Gefahr keinesfalls unterschätzen sollte.
rechts von der Schotterstraße ab und stehen auf versteckten Waldlichtungen oder an kleinen Seen. Hier haben wir schon in der ersten Nacht ein Erlebnis, das wir ganz sicher niemals vergessen werden. Kochen in der outdoor-Küche können wir an diesem Abend vergessen, es sind einfach viel zu viele Mosquitos da, da hilft kein Einsprühen mit „Off“, da hilft gar nix, ich versuche tapfer draußen ein Bier zu trinken, muss aber nach drei Minuten aufgeben und nach drinnen flüchten. Es gibt dann Salat und, da ich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, Dressings und anderes in unsere Abwasch/Waschbecken zu leeren (ich erspare Euch hier die Details, wie ich den verklebten Abwasserschlauch durchblasen wollte und danach das ganze Badezimmer bis zur Decke putzen musste,…) leere ich den Rest vom Dressing vor die Türe (ja, sorry, ich weiß, man macht das nicht,…). Um ca. halb drei Uhr früh weckt mich ein lautes Kratzen und Schnüffeln an unserer Tür. Ich krabble zum Fußende unseres Betts und, da es hier zu dieser Jahreszeit draußen ja die ganze Nacht nicht dunkel wird, sehe ich durch das, wie immer, offene Fenster, wie ein Braunbär auf seinen Hinterbeinen dort steht wo sich normalerweise unsere Leiter befindet und an der Tür der Wohnkabine kratzt und schnüffelt. Leider bin ich bei meinem aufgeregten Versuch mein Handy zu finden und nebenbei noch Karl zu wecken, viel zu laut und bis ich wieder beim Fenster bin, hat er schon das Weite gesucht. Er bleibt dann nochmal kurz stehen und schaut zu uns herüber, als ich aber das Fliegengitter öffne, um ein Foto zu machen, verschwindet er endgültig im Gebüsch. Ob ihn wirklich der Geruch des Essigs angelockt hat oder einfach die Neugier – Keine Ahnung. Zurück bleibt für uns die Gewissheit, dass die Bären hier wirklich ganz nahe sind und man die Gefahr keinesfalls unterschätzen sollte.
Wir überlegen, spontan einen Abstecher nach Osten bis an die Grenze der „North West Territorries“  einzulegen, es reizt uns die Beschreibung der „North Canol Road“ als verkehrsärmste
einzulegen, es reizt uns die Beschreibung der „North Canol Road“ als verkehrsärmste Straße Yukons, über namenlose Pässe, Berge und Seen. Wir biegen also ab, schon nach wenigen Kilometern wird unser Vorhaben aber bereits im 400 Einwohner Ort „Ross River“ gestoppt. Hier sollte uns eine Fähre über den gleichnamigen Fluss bringen, aber bereits die Zufahrtsstraße zur Fähre ist wegen Hochwasser für den Verkehr gesperrt. Eine
Straße Yukons, über namenlose Pässe, Berge und Seen. Wir biegen also ab, schon nach wenigen Kilometern wird unser Vorhaben aber bereits im 400 Einwohner Ort „Ross River“ gestoppt. Hier sollte uns eine Fähre über den gleichnamigen Fluss bringen, aber bereits die Zufahrtsstraße zur Fähre ist wegen Hochwasser für den Verkehr gesperrt. Eine  Hängebrücke
Hängebrücke gibt es nur für Fußgänger aber sogar diese ist für einen Spaziergang nicht begehbar. In Ross River hält uns dann eher nichts mehr, das Hotel hat längst bessere Zeiten gesehen,
gibt es nur für Fußgänger aber sogar diese ist für einen Spaziergang nicht begehbar. In Ross River hält uns dann eher nichts mehr, das Hotel hat längst bessere Zeiten gesehen,  tanken kann man dort wohl auch schon länger nicht mehr, die Kirche hätte uns zwar am Sonntag willkommen
tanken kann man dort wohl auch schon länger nicht mehr, die Kirche hätte uns zwar am Sonntag willkommen  geheißen, da aber heute erst Mittwoch ist – Auch keine Option. Wir drehen um und fahren weiter Richtung Norden.
geheißen, da aber heute erst Mittwoch ist – Auch keine Option. Wir drehen um und fahren weiter Richtung Norden.
Nach den wunderbaren Tagen und Nächten in der Einsamkeit freuen wir uns jetzt wieder auf etwas  „Stadtluft“ und erreichen „Dawson City“. 1898 zur Zeit des Goldrauschs war
„Stadtluft“ und erreichen „Dawson City“. 1898 zur Zeit des Goldrauschs war  Dawson mit 30.000 Einwohnern die größte Stadt nördlich von Vancouver, heute leben im Sommer immerhin ca. 2.000 Menschen hier, überwiegend vom Tourismus. Das überschaubare Städtchen wurde angeblich nach
Dawson mit 30.000 Einwohnern die größte Stadt nördlich von Vancouver, heute leben im Sommer immerhin ca. 2.000 Menschen hier, überwiegend vom Tourismus. Das überschaubare Städtchen wurde angeblich nach  Originalplänen wieder aufgebaut, was als ganz gut gelungen erscheint. Geschotterte Straßen, hölzerne Gehsteige und alte Fassaden prägen das Bild. Ein bisschen erinnert es mich an Bad Ischl, wo bei uns alles „Kaiser…“ heißt, gibt es hier „Klondyke-Eissalons“, „Gold-Rush-Souvenirläden,
Originalplänen wieder aufgebaut, was als ganz gut gelungen erscheint. Geschotterte Straßen, hölzerne Gehsteige und alte Fassaden prägen das Bild. Ein bisschen erinnert es mich an Bad Ischl, wo bei uns alles „Kaiser…“ heißt, gibt es hier „Klondyke-Eissalons“, „Gold-Rush-Souvenirläden,  „Bonanza-Goldwaschanlagen“, einfach alles wird rund ums Gold vermarktet. Das leider mit Brettern vernagelte Kultrestaurant „Klondyke-Kate’s“, wo es früher das „Original Wiener Schnitzel“ als Spezialität gegeben haben soll, hat aber
„Bonanza-Goldwaschanlagen“, einfach alles wird rund ums Gold vermarktet. Das leider mit Brettern vernagelte Kultrestaurant „Klondyke-Kate’s“, wo es früher das „Original Wiener Schnitzel“ als Spezialität gegeben haben soll, hat aber  leider, wie auch einige andere Geschäfte und Lokale, „zwei Jahre Corona nicht überlebt“, so sagt man uns im Visitors Center bedauernd und so bleibt uns am Abend nur der Besuch im Club von „Diamond tooth Gertie’s“ (die namensgebende Dame mit dem Diamanten im
leider, wie auch einige andere Geschäfte und Lokale, „zwei Jahre Corona nicht überlebt“, so sagt man uns im Visitors Center bedauernd und so bleibt uns am Abend nur der Besuch im Club von „Diamond tooth Gertie’s“ (die namensgebende Dame mit dem Diamanten im Schneidezahn war angeblich früher hier in der Stadt eine echt heiße Nummer!). Die Musik- und Tanzshow ist zwar grottenschlecht, der Abend aber trotzdem eine vergnügliche Abwechslung, ich verzocke etwas
Schneidezahn war angeblich früher hier in der Stadt eine echt heiße Nummer!). Die Musik- und Tanzshow ist zwar grottenschlecht, der Abend aber trotzdem eine vergnügliche Abwechslung, ich verzocke etwas  Geld beim Roulette und den „einarmigen Banditen“ und als wir um ca. 00.45 Uhr das Lokal verlassen, geht hinter dem Unimog gerade die Sonne unter. Diese nicht endenden Tage sind schon cool
Geld beim Roulette und den „einarmigen Banditen“ und als wir um ca. 00.45 Uhr das Lokal verlassen, geht hinter dem Unimog gerade die Sonne unter. Diese nicht endenden Tage sind schon cool  hier im Sommer. Dawson City ist dann wie ein Schmelztigel von Overlandern. Es hat was von einem großen Familientreffen, ständig kommen und gehen Leute in den verschiedensten Fahrzeugen, von denen man viele schon mal unterwegs gesehen oder getroffen hat. Man freut sich über ein Wiedersehen, quatscht ein bisschen über das Erlebte oder Geplante und dann verschwindet jeder wieder in seine eigene Richtung.
hier im Sommer. Dawson City ist dann wie ein Schmelztigel von Overlandern. Es hat was von einem großen Familientreffen, ständig kommen und gehen Leute in den verschiedensten Fahrzeugen, von denen man viele schon mal unterwegs gesehen oder getroffen hat. Man freut sich über ein Wiedersehen, quatscht ein bisschen über das Erlebte oder Geplante und dann verschwindet jeder wieder in seine eigene Richtung.
Wir verzichten nach kurzer Überlegung auf eine Fahrt über den „Dempster Highway“ bis hinauf nach  Inuvik, da wir irgendwie das Gefühl haben, dass der inzwischen schon ziemlich von Wohnmobil-Touristen überlaufen ist (ständig hört man von allen Seiten“Habt ihr auch schon den Dempster gemacht?“). Die Strecke wir zwar als landschaftlich sehr schön beschrieben, aber wir wollen ja ohnedies hinauf zur Prudhoe Bay und
Inuvik, da wir irgendwie das Gefühl haben, dass der inzwischen schon ziemlich von Wohnmobil-Touristen überlaufen ist (ständig hört man von allen Seiten“Habt ihr auch schon den Dempster gemacht?“). Die Strecke wir zwar als landschaftlich sehr schön beschrieben, aber wir wollen ja ohnedies hinauf zur Prudhoe Bay und dort ans Arktische Meer, dem offiziellen Beginn der „Panamericana“. Vorerst aber begeben wir uns auf die Fähre, die Gott sei Dank, trotz sehr hohem Wasserstand, in Betrieb ist und die uns über den Yukon River bringt. Im Anschluss daran nehmen wir den „Top of the World Highway“, der dann seinem Namen alle Ehre macht. Hoch über der Baumgrenze führt er immer so auf 1.000 m dahin und beschert uns bei Traumwetter einen großartigen Ausblick nach dem anderen. Hier oben, mitten in den Bergen, wartet dann die Grenzstation zur USA und zum „Abenteuer Alaska“ auf uns.
dort ans Arktische Meer, dem offiziellen Beginn der „Panamericana“. Vorerst aber begeben wir uns auf die Fähre, die Gott sei Dank, trotz sehr hohem Wasserstand, in Betrieb ist und die uns über den Yukon River bringt. Im Anschluss daran nehmen wir den „Top of the World Highway“, der dann seinem Namen alle Ehre macht. Hoch über der Baumgrenze führt er immer so auf 1.000 m dahin und beschert uns bei Traumwetter einen großartigen Ausblick nach dem anderen. Hier oben, mitten in den Bergen, wartet dann die Grenzstation zur USA und zum „Abenteuer Alaska“ auf uns.
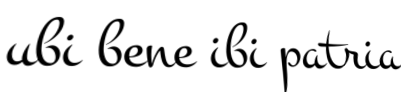




Hallo liebe Rebecca und Karl,
ihr geht mir schon sehr ab auf den gemeinsamen Samstag bzw. Sonntagsstammtischen. Wie immer ein sehr sehr cooler Bericht. Leider viel zu kurz. So Gott will, sehen wir uns Anfang November in Mexiko.
Liebe Grüße Fuzi.
Ps. sogar der Gschwandtner kann Euren Blog schon lesen.
Lieber Fuzi, freue mich sehr, dass wenigstens einer ab und zu hier einen Kommentar hinterlässt 😀! Vermisse unsere Stammtische auch und würde mich sehr über ein Wiedersehen in México freuen – Halte die Daumen dass es klappt! Liebe Grüße an alle Rebecca und Karl