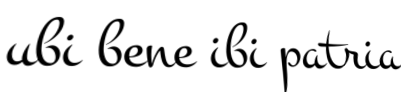Jetzt also doch der Süden oder „Ich weiß noch nicht genau ob ich Honduras mag…“
Der Grenzübertritt von El Salvdor nach Honduras ist dann eigentlich wieder einmal kein Problem – „Eigentlich!“ In El  Salvador werden wir, wie bereits bei der Einreise, kostenlos und
Salvador werden wir, wie bereits bei der Einreise, kostenlos und  schnell abgefertigt, fahren dann, wie fast überall, über die Brücke des Grenzflusses und sofort nach deren Ende springt einer der üblichen „Grenzhelfer“ auf Karl’s Seite aufs Trittbrett des Unimogs und zeigt uns, wo wir vor dem Gebäude, in dem sich der honduranische Zoll und die Immigration befinden, parken sollen. Nachdem wir an der Grenze zu Guatemala so gute Erfahrungen mit dem jungen Helfer gemacht haben, lassen wir uns darauf ein und während wir noch bei der Immigration unsere Stempel in die Pässe bekommen und hier zum ersten Mal seit den USA sogar wieder Fingerabdrücke abgeben müssen, kümmert er sich mit allen unseren Papieren (Kopien natürlich) bereits gegenüber, am Schalter vom Zoll, um die Einreisegenehmigung für den Unimog. Wir lassen ihn machen, wechseln inzwischen bei einem der obligat auftauchenden Geldwechsler unsere ersten „Lempira“, die nach einem honduranischen Freiheitskämpfer benannte
schnell abgefertigt, fahren dann, wie fast überall, über die Brücke des Grenzflusses und sofort nach deren Ende springt einer der üblichen „Grenzhelfer“ auf Karl’s Seite aufs Trittbrett des Unimogs und zeigt uns, wo wir vor dem Gebäude, in dem sich der honduranische Zoll und die Immigration befinden, parken sollen. Nachdem wir an der Grenze zu Guatemala so gute Erfahrungen mit dem jungen Helfer gemacht haben, lassen wir uns darauf ein und während wir noch bei der Immigration unsere Stempel in die Pässe bekommen und hier zum ersten Mal seit den USA sogar wieder Fingerabdrücke abgeben müssen, kümmert er sich mit allen unseren Papieren (Kopien natürlich) bereits gegenüber, am Schalter vom Zoll, um die Einreisegenehmigung für den Unimog. Wir lassen ihn machen, wechseln inzwischen bei einem der obligat auftauchenden Geldwechsler unsere ersten „Lempira“, die nach einem honduranischen Freiheitskämpfer benannte  Währung von Honduras, die als erste auf unserer Reise komplett ohne Münzen auskommt und warten dann auf die Fertigstellung unserer Fahrzeugpapiere. Zwischendurch kommt unser Helfer um US$ von uns zu holen, die bevorzugte Währung an allen Grenzen, die er am Schalter einzahlt, gleich darauf teilt er uns mit, dass die Papiere fertig seien und begleitet uns damit zum Unimog. Dort geht dann plötzlich alles ganz schnell: Er zaubert zwischen den Papieren noch zwei Dokumente hervor, auf denen jeweils Beträge in Lempira stehen, die er angeblich für uns noch zusätzlich am Schalter bezahlt habe, was wir natürlich nicht hundertprozentig bestreiten können – wir waren ja nicht dabei… . Es sind keine allzu großen Beträge und daher bezahle ich ihm diese von unserem frisch gewechselten Geld. Fast gleichzeitig kommt plötzlich von hinten ein „Kontrolleur“, der unsere Papiere nimmt und die Kennzeichen vom Unimog kontrolliert, ein zweiter kommt dazu, alle reden in schnellem Spanisch durcheinander, unser „Helfer“ meint, es würde irgendetwas nicht stimmen, in einem Papier das noch von unserer allerersten Einreise in die CA-4-Staaten an der Grenze von Belize zu Guatemala stammt, sei wohl beim Kennzeichen
Währung von Honduras, die als erste auf unserer Reise komplett ohne Münzen auskommt und warten dann auf die Fertigstellung unserer Fahrzeugpapiere. Zwischendurch kommt unser Helfer um US$ von uns zu holen, die bevorzugte Währung an allen Grenzen, die er am Schalter einzahlt, gleich darauf teilt er uns mit, dass die Papiere fertig seien und begleitet uns damit zum Unimog. Dort geht dann plötzlich alles ganz schnell: Er zaubert zwischen den Papieren noch zwei Dokumente hervor, auf denen jeweils Beträge in Lempira stehen, die er angeblich für uns noch zusätzlich am Schalter bezahlt habe, was wir natürlich nicht hundertprozentig bestreiten können – wir waren ja nicht dabei… . Es sind keine allzu großen Beträge und daher bezahle ich ihm diese von unserem frisch gewechselten Geld. Fast gleichzeitig kommt plötzlich von hinten ein „Kontrolleur“, der unsere Papiere nimmt und die Kennzeichen vom Unimog kontrolliert, ein zweiter kommt dazu, alle reden in schnellem Spanisch durcheinander, unser „Helfer“ meint, es würde irgendetwas nicht stimmen, in einem Papier das noch von unserer allerersten Einreise in die CA-4-Staaten an der Grenze von Belize zu Guatemala stammt, sei wohl beim Kennzeichen  (GM-469 FF) ein „F“ zuwenig, aber – no problemo – er würde sich gleich um alles kümmern – und dann geht die große Verteilerei auch schon los. Der „Kontrolleur“ soll 10 US$ bekommen, damit er das fehlende „F“ übersieht, der zweite für etwas was wir nicht verstehen, soll 20 US$ kriegen und schließlich hätte ja er, unser „Helfer“, für seine Dienste auch noch nichts bekommen… . Genau in diesem Moment platzt Karl der Kragen und er macht den Männern unmissverständlich klar, dass es jetzt insgesamt noch genau 10 US$ gäbe, wie sie sich diese aufteilen würden sei ihm egal. Damit gehen wir einfach zum Unimog und steigen ein. Der „Helfer“ und seine Kumpels motzen zwar noch hinterher, aber wir starten und fahren einfach weg, ohne dass uns jemand aufhält. Hinterher wird uns klar, dass bereits die zusätzliche Zahlung der Lempira sicher ungerechtfertigt war und dass wir somit ca. um ein Drittel mehr als notwendig bezahlt haben. Aber ok, diesmal geht der Punkt also an die „Helfer“, wir waren eindeutig selber schuld, weil wir es uns zu bequem gemacht und viel zu wenig aufgepasst haben. Ganz sicher wird uns das aber kein zweites Mal passieren, das steht fest!
(GM-469 FF) ein „F“ zuwenig, aber – no problemo – er würde sich gleich um alles kümmern – und dann geht die große Verteilerei auch schon los. Der „Kontrolleur“ soll 10 US$ bekommen, damit er das fehlende „F“ übersieht, der zweite für etwas was wir nicht verstehen, soll 20 US$ kriegen und schließlich hätte ja er, unser „Helfer“, für seine Dienste auch noch nichts bekommen… . Genau in diesem Moment platzt Karl der Kragen und er macht den Männern unmissverständlich klar, dass es jetzt insgesamt noch genau 10 US$ gäbe, wie sie sich diese aufteilen würden sei ihm egal. Damit gehen wir einfach zum Unimog und steigen ein. Der „Helfer“ und seine Kumpels motzen zwar noch hinterher, aber wir starten und fahren einfach weg, ohne dass uns jemand aufhält. Hinterher wird uns klar, dass bereits die zusätzliche Zahlung der Lempira sicher ungerechtfertigt war und dass wir somit ca. um ein Drittel mehr als notwendig bezahlt haben. Aber ok, diesmal geht der Punkt also an die „Helfer“, wir waren eindeutig selber schuld, weil wir es uns zu bequem gemacht und viel zu wenig aufgepasst haben. Ganz sicher wird uns das aber kein zweites Mal passieren, das steht fest!
Durch den kurzfristig geänderten Grenzübergang „betreten“ wir Honduras jetzt viel weiter im Süden als ursprünglich geplant. Dieser Teil des Landes, wo es immer extrem heiß ist, wird von Touristen eher gemieden, mit Ausnahme von denen, die auf  der hier entlangführenden Panamericana das Land in nur wenigen Stunden durchqueren, um es so schnell wie möglich hinter sich zu lassen. Das erste was uns auffällt, als die Grenze überquert ist, ist die unendlich öde, vertrocknete Landschaft rund um uns herum. Nach dem fast überall grünen, blühenden El Salvador ist es hier als hätte man aus unserem Reisefilm die Farbe herausgeschüttet und durch alle möglichen Brauntöne ersetzt. Honduras verfügt nur über 124 km Pazifikküste und daher wollten wir diese eigentlich gar nicht besuchen, umso mehr, als wir gerade in El Salvador wirklich viel Zeit an den dort wunderschönen, einsamen Pazifikstränden verbracht haben. Aber nun sind wir schon einmal in der Nähe der Westküste eingereist und irgendwo müssen wir ja auch
der hier entlangführenden Panamericana das Land in nur wenigen Stunden durchqueren, um es so schnell wie möglich hinter sich zu lassen. Das erste was uns auffällt, als die Grenze überquert ist, ist die unendlich öde, vertrocknete Landschaft rund um uns herum. Nach dem fast überall grünen, blühenden El Salvador ist es hier als hätte man aus unserem Reisefilm die Farbe herausgeschüttet und durch alle möglichen Brauntöne ersetzt. Honduras verfügt nur über 124 km Pazifikküste und daher wollten wir diese eigentlich gar nicht besuchen, umso mehr, als wir gerade in El Salvador wirklich viel Zeit an den dort wunderschönen, einsamen Pazifikstränden verbracht haben. Aber nun sind wir schon einmal in der Nähe der Westküste eingereist und irgendwo müssen wir ja auch übernachten, also verlassen wir den von uns sowieso ungeliebten Panamerican-Highway nach nur zwanzig Kilometern wieder und folgen einer kleinen Straße Richtung Meer. Es geht durch Zuckerrohrfelder und winzige Dörfer, die Wäsche wird hier noch im Fluss gewaschen, es begegnen uns Ochsengespanne, irgendwie scheint es uns hier um Jahre „zurückgebeamt“ zu haben. Niemand winkt hier, im Gegenteil, die Menschen wirken fast
übernachten, also verlassen wir den von uns sowieso ungeliebten Panamerican-Highway nach nur zwanzig Kilometern wieder und folgen einer kleinen Straße Richtung Meer. Es geht durch Zuckerrohrfelder und winzige Dörfer, die Wäsche wird hier noch im Fluss gewaschen, es begegnen uns Ochsengespanne, irgendwie scheint es uns hier um Jahre „zurückgebeamt“ zu haben. Niemand winkt hier, im Gegenteil, die Menschen wirken fast ein wenig abweisend, wir schauen in ausgemergelte Gesichter, es verfolgen uns stechende Blicke (obwohl Karl meint ich bilde mir das nur ein…) und es wird uns schlagartig bewusst, dass wir jetzt in einem Land sind, in dem, insbesonders außerhalb der Städte, ca. 70% der Menschen unter der Armutsgrenze leben. Zum ersten Mal seit wir unterwegs sind, befällt mich ein bedrückendes Gefühl. Wie müssen wir auf diese Menschen wirken, wie wir hier mit dem großen, voll ausgestatteten Unimog bei Ihnen aufkreuzen, wo sie wahrscheinlich oft nicht wissen, wie sie ihre Familie bis zum Ende der Woche ernähren sollen. Das alles geht mir durch den Kopf während wir uns auf dem, die letzten zwanzig Kilometer wirklich extrem schlechten Schotterweg der Küste und dem winzigen Ort „Playa Blanca“ nähern. Dieser besteht nur aus wenigen Häusern, die sich eng um eine wunderschöne, kleine Sandbucht gruppieren, hinter der dann sofort wieder die Hügel ansteigen (etwa so wie 20 Häuser von Hallstatt, nur halt am Meer!). Der Schotterweg endet genau an der engsten Stelle mitten im Dorf, es gibt hier kaum einen ebenen Fleck den wir zum Übernachten nützen könnten. Wir fahren ein Stück hinauf, wo es neben einer Hütte einen flachen Platz gibt. Als wir aussteigen, schaut uns die ganze Familie die dort wohnt nur ungläubig an.
ein wenig abweisend, wir schauen in ausgemergelte Gesichter, es verfolgen uns stechende Blicke (obwohl Karl meint ich bilde mir das nur ein…) und es wird uns schlagartig bewusst, dass wir jetzt in einem Land sind, in dem, insbesonders außerhalb der Städte, ca. 70% der Menschen unter der Armutsgrenze leben. Zum ersten Mal seit wir unterwegs sind, befällt mich ein bedrückendes Gefühl. Wie müssen wir auf diese Menschen wirken, wie wir hier mit dem großen, voll ausgestatteten Unimog bei Ihnen aufkreuzen, wo sie wahrscheinlich oft nicht wissen, wie sie ihre Familie bis zum Ende der Woche ernähren sollen. Das alles geht mir durch den Kopf während wir uns auf dem, die letzten zwanzig Kilometer wirklich extrem schlechten Schotterweg der Küste und dem winzigen Ort „Playa Blanca“ nähern. Dieser besteht nur aus wenigen Häusern, die sich eng um eine wunderschöne, kleine Sandbucht gruppieren, hinter der dann sofort wieder die Hügel ansteigen (etwa so wie 20 Häuser von Hallstatt, nur halt am Meer!). Der Schotterweg endet genau an der engsten Stelle mitten im Dorf, es gibt hier kaum einen ebenen Fleck den wir zum Übernachten nützen könnten. Wir fahren ein Stück hinauf, wo es neben einer Hütte einen flachen Platz gibt. Als wir aussteigen, schaut uns die ganze Familie die dort wohnt nur ungläubig an.  Ich versuche sie zu fragen, ob wir hier übernachten dürfen und was es kostet, sie sagen aber irgendwie nicht ja und nicht nein, schauen uns und den Unimog nur alle mit großen Augen an, ich verstehe kein Wort von ihrem Spanisch und
Ich versuche sie zu fragen, ob wir hier übernachten dürfen und was es kostet, sie sagen aber irgendwie nicht ja und nicht nein, schauen uns und den Unimog nur alle mit großen Augen an, ich verstehe kein Wort von ihrem Spanisch und  schließlich geben wir auf und finden ein Stück weiter vorne, auf einem privaten Parkplatz, einen ebenfalls halbwegs ebenen Platz. Der Eigentümer sagt uns, die Übernachtung hier koste nichts, worüber wir uns sehr freuen und wir stellen somit den Unimog ab und gehen die paar Schritte zum Strand hinunter, um zu schauen was es dort so gibt. Außer einer wunderschönen Aussicht auf die kleine Bucht und ein paar Einheimischen, die hier wohl samt mitgebrachten Kühlboxen den Sonntag verbracht haben, ist hier so gut wie nichts los. Es gibt kein Restaurant, nur ein Fischer hat oben an seiner Hütte ein handgeschriebenes Schild angebracht, auf dem er Fisch und Garnelen anbietet. Wir fragen ihn, ob wir ihm zwei Bier abkaufen können, aber Getränke gibt es hier auch keine. Wir holen uns dann die Bier aus dem Unimog und genießen noch eine Zeit lang das Strandpanorama, bis die Sonne untergeht. Dann wechseln wir auf den einzigen vorhandenen Biertisch im offenen Teil vom Haus des Fischers und bestellen uns dort zwei gegrillte Fische, serviert mit ganz fein geschnittenen, frittierten
schließlich geben wir auf und finden ein Stück weiter vorne, auf einem privaten Parkplatz, einen ebenfalls halbwegs ebenen Platz. Der Eigentümer sagt uns, die Übernachtung hier koste nichts, worüber wir uns sehr freuen und wir stellen somit den Unimog ab und gehen die paar Schritte zum Strand hinunter, um zu schauen was es dort so gibt. Außer einer wunderschönen Aussicht auf die kleine Bucht und ein paar Einheimischen, die hier wohl samt mitgebrachten Kühlboxen den Sonntag verbracht haben, ist hier so gut wie nichts los. Es gibt kein Restaurant, nur ein Fischer hat oben an seiner Hütte ein handgeschriebenes Schild angebracht, auf dem er Fisch und Garnelen anbietet. Wir fragen ihn, ob wir ihm zwei Bier abkaufen können, aber Getränke gibt es hier auch keine. Wir holen uns dann die Bier aus dem Unimog und genießen noch eine Zeit lang das Strandpanorama, bis die Sonne untergeht. Dann wechseln wir auf den einzigen vorhandenen Biertisch im offenen Teil vom Haus des Fischers und bestellen uns dort zwei gegrillte Fische, serviert mit ganz fein geschnittenen, frittierten  Platanos (Kochbananen), was dann wirklich köstlich schmeckt. Neben uns wird über offenem Feuer unser Essen gekocht, gleich daneben werden die Kinder der Fischerfamilie mit Hilfe eines Schlauchs gewaschen und dann durch einen Vorhang ins Innere der Hütte befördert, wo sie wahrscheinlich ins Bett gebracht werden. Sozusagen essen wir mitten im offenen Wohnzimmer der Familie, mit wunderbarem Blick aufs direkt angrenzende Meer. Vom erhöhten Standplatz des Unimogs aus genießen wir dann später noch ein fantastisches Panorama über das ganze Dorf und die stille Bucht und stoßen mit einer Flasche Wein nochmal auf das Wohl von Karl’s Enkel an. Als wir am nächsten Vormittag den Parkplatz verlassen wollen, kommt der Besitzer und meint, er kriege jetzt 300 Lempira (€ 12) für diese Nacht. Keine Spur mehr von wegen gratis wie am Vortag ausgemacht. Super, nach der Abzocke an der Grenze geht das hier ja gut weiter,…! Karl gibt ihm dann, um des lieben Friedens willen, 100 Lempira, damit gibt er sich missmutig auch zufrieden und wir holpern auf der Schotterstraße zurück Richtung Asphalt. Holprig sind somit auch unsere ersten Begegnungen mit diesem Land verlaufen, gar nicht wie bisher, wo alle uns überall immer so herzlich willkommen geheißen haben. Natürlich sind wir erst zwei Tage hier, aber trotzdem bin vor allem ich gespannt, ob es mir im Laufe der Zeit gelingen wird, mit Honduras doch noch warm zu werden… .
Platanos (Kochbananen), was dann wirklich köstlich schmeckt. Neben uns wird über offenem Feuer unser Essen gekocht, gleich daneben werden die Kinder der Fischerfamilie mit Hilfe eines Schlauchs gewaschen und dann durch einen Vorhang ins Innere der Hütte befördert, wo sie wahrscheinlich ins Bett gebracht werden. Sozusagen essen wir mitten im offenen Wohnzimmer der Familie, mit wunderbarem Blick aufs direkt angrenzende Meer. Vom erhöhten Standplatz des Unimogs aus genießen wir dann später noch ein fantastisches Panorama über das ganze Dorf und die stille Bucht und stoßen mit einer Flasche Wein nochmal auf das Wohl von Karl’s Enkel an. Als wir am nächsten Vormittag den Parkplatz verlassen wollen, kommt der Besitzer und meint, er kriege jetzt 300 Lempira (€ 12) für diese Nacht. Keine Spur mehr von wegen gratis wie am Vortag ausgemacht. Super, nach der Abzocke an der Grenze geht das hier ja gut weiter,…! Karl gibt ihm dann, um des lieben Friedens willen, 100 Lempira, damit gibt er sich missmutig auch zufrieden und wir holpern auf der Schotterstraße zurück Richtung Asphalt. Holprig sind somit auch unsere ersten Begegnungen mit diesem Land verlaufen, gar nicht wie bisher, wo alle uns überall immer so herzlich willkommen geheißen haben. Natürlich sind wir erst zwei Tage hier, aber trotzdem bin vor allem ich gespannt, ob es mir im Laufe der Zeit gelingen wird, mit Honduras doch noch warm zu werden… .
Durchs Hochland bis in die Brauerei oder „Auf den Spuren von Kaffee, Weißbier und Lebensrettern“
Wir verlassen den ausgedörrten, unfreundlichen Süden und fahren landeinwärts in die leider nicht viel weniger heiße  Hauptstadt
Hauptstadt  des Landes, nach „Tegucigalpa“ oder „Tela“ wie sie von den
des Landes, nach „Tegucigalpa“ oder „Tela“ wie sie von den  Einheimischen auch genannt wird. Nachdem wir in El Salvador auf den Kauf einer SIM-Karte verzichtet hatten, weil die in Guatemala gekaufte Claro-SIM dort, zwar mit hohen Roamingkosten, aber immerhin, noch funktionierte, kaufen wir uns jetzt hier in Honduras eine neue und sind begeistert, dass es hier 20 GB für umgerechnet nur 8 Euro gibt. Sonst hält uns eigentlich nichts in der Hauptstadt und wir flüchten anschließend vor der Hitze in das nahegelegene Bergdorf „Santa Lucia“, das auf 1.500 m liegt.
Einheimischen auch genannt wird. Nachdem wir in El Salvador auf den Kauf einer SIM-Karte verzichtet hatten, weil die in Guatemala gekaufte Claro-SIM dort, zwar mit hohen Roamingkosten, aber immerhin, noch funktionierte, kaufen wir uns jetzt hier in Honduras eine neue und sind begeistert, dass es hier 20 GB für umgerechnet nur 8 Euro gibt. Sonst hält uns eigentlich nichts in der Hauptstadt und wir flüchten anschließend vor der Hitze in das nahegelegene Bergdorf „Santa Lucia“, das auf 1.500 m liegt.  Es ist kühler und wunderschön hier oben, die engen, kopfsteingepflasterten Straßen sind zwar wieder einmal eine echte Herausforderung für die Breite des Unimogs, aber letztendlich schaffen wir auch die schmalsten Passagen und finden einen Platz zum Übernachten direkt hinter der kleinen Kirche. Von dort aus bewundern wir den Ausblick auf die Lichter der nahegelegenen Hauptstadt
Es ist kühler und wunderschön hier oben, die engen, kopfsteingepflasterten Straßen sind zwar wieder einmal eine echte Herausforderung für die Breite des Unimogs, aber letztendlich schaffen wir auch die schmalsten Passagen und finden einen Platz zum Übernachten direkt hinter der kleinen Kirche. Von dort aus bewundern wir den Ausblick auf die Lichter der nahegelegenen Hauptstadt  am Horizont und machen dann noch einen Rundgang durch das kleine Dorf, wo wir nicht nur wieder auf lächelnde, freundliche Menschen treffen, sondern auch zum ersten Mal das wirklich köstliche honduranische Bier namens „Salva Vida“ probieren. Der Name ist Programm, bei der Hitze in diesem Land erweist es sich wirklich oft als echter „Lebensretter“.
am Horizont und machen dann noch einen Rundgang durch das kleine Dorf, wo wir nicht nur wieder auf lächelnde, freundliche Menschen treffen, sondern auch zum ersten Mal das wirklich köstliche honduranische Bier namens „Salva Vida“ probieren. Der Name ist Programm, bei der Hitze in diesem Land erweist es sich wirklich oft als echter „Lebensretter“.
Wir bleiben auch am nächsten Tag noch im kühlen „Santa Lucia“, spazieren nocheinmal gemütlich durch das symphatische  Bergdorf, vorbei an dem kleinen Teich, an dem wir den in der Sonne liegenden Wasserschildkröten
Bergdorf, vorbei an dem kleinen Teich, an dem wir den in der Sonne liegenden Wasserschildkröten  zuschauen und beschließen dabei, noch ein Stück weiter ins honduranische Hochland hineinzufahren, bevor wir uns wieder in die schwül-heiße Küstennähe wagen. Über kleine Bergstraßen fahren wir durch das hier immer grüner werdende Hochland, vorbei an den ersten Kaffeeplantagen bis in die höchstgelegene Stadt von Honduras, nach „La Esperanza“. Diese mittelgroße Stadt gefällt uns gleich von Anfang an
zuschauen und beschließen dabei, noch ein Stück weiter ins honduranische Hochland hineinzufahren, bevor wir uns wieder in die schwül-heiße Küstennähe wagen. Über kleine Bergstraßen fahren wir durch das hier immer grüner werdende Hochland, vorbei an den ersten Kaffeeplantagen bis in die höchstgelegene Stadt von Honduras, nach „La Esperanza“. Diese mittelgroße Stadt gefällt uns gleich von Anfang an  sehr gut, es gibt dort zwar keine größeren Sehenswürdigkeiten, aber dafür alles was wir gerade so brauchen. Wir finden einen Platz im Zentrum, wo wir für 200 Lempira (8 Euro) bewacht stehen können und wo der Unimog gleichzeitig seine längst fällige,
sehr gut, es gibt dort zwar keine größeren Sehenswürdigkeiten, aber dafür alles was wir gerade so brauchen. Wir finden einen Platz im Zentrum, wo wir für 200 Lempira (8 Euro) bewacht stehen können und wo der Unimog gleichzeitig seine längst fällige,  per Hand und Dampfstrahler durchgeführte, Komplettwäsche für echt günstige 150 Lempira erhält. Außerdem hat sich in letzter Zeit wieder einmal jede Menge Wäsche angesammelt und wir
per Hand und Dampfstrahler durchgeführte, Komplettwäsche für echt günstige 150 Lempira erhält. Außerdem hat sich in letzter Zeit wieder einmal jede Menge Wäsche angesammelt und wir finden in der Nähe eine Wäscherei, in die wir die drei großen Säcke bringen. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei eigentlich um einen Waschsalon handelt, wo man seine Wäsche
finden in der Nähe eine Wäscherei, in die wir die drei großen Säcke bringen. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei eigentlich um einen Waschsalon handelt, wo man seine Wäsche selbst wäscht, was wir seit inklusive Mexico nie mehr irgendwo gesehen haben. In den letzten „Self-Service-Waschsalons“ in den USA habe ich mich noch mit den großteils uralten „Top-Loader-Maschinen“ geplagt, in die man die Wäsche oben hineinfüllt und in denen diese dann, wie mit einem Rührwerk, durchgerührt wird,
selbst wäscht, was wir seit inklusive Mexico nie mehr irgendwo gesehen haben. In den letzten „Self-Service-Waschsalons“ in den USA habe ich mich noch mit den großteils uralten „Top-Loader-Maschinen“ geplagt, in die man die Wäsche oben hineinfüllt und in denen diese dann, wie mit einem Rührwerk, durchgerührt wird,  wobei das Wasser nur am Anfang warm ist, dann aber nicht mehr aufgeheizt wird, was sich dann meistens in einem entsprechend miesen Waschergebnis äußert. Hier, mitten im tiefsten Honduras, finden wir also modernste, europäische Waschmaschinen vor und die junge Dame die den Salon betreut, bietet uns außerdem sofort an, den Wechsel der Wäsche von den Waschmaschinen in die Trockner für uns zu übernehmen und uns per whatsApp zu verständigen, wenn alles fertig ist. Das ist wirklich ein Rundum-Service, denn so müssen wir nicht warten, sondern können inzwischen gemütlich einen Stadtbummel unternehmen, bei dem
wobei das Wasser nur am Anfang warm ist, dann aber nicht mehr aufgeheizt wird, was sich dann meistens in einem entsprechend miesen Waschergebnis äußert. Hier, mitten im tiefsten Honduras, finden wir also modernste, europäische Waschmaschinen vor und die junge Dame die den Salon betreut, bietet uns außerdem sofort an, den Wechsel der Wäsche von den Waschmaschinen in die Trockner für uns zu übernehmen und uns per whatsApp zu verständigen, wenn alles fertig ist. Das ist wirklich ein Rundum-Service, denn so müssen wir nicht warten, sondern können inzwischen gemütlich einen Stadtbummel unternehmen, bei dem  wir uns unter anderem „La Gruta“ anschauen, eine winzige, sehr alte, in den Felsen gehauene Kapelle,
wir uns unter anderem „La Gruta“ anschauen, eine winzige, sehr alte, in den Felsen gehauene Kapelle, die man nur über teils riesige, unebene Stufen erreicht. Außerdem stehen wir bei unserem Rundgang plötzlich vor einem Lokal, das mit einem großen „Paulaner“-Schild wirbt und Karl bekommt
die man nur über teils riesige, unebene Stufen erreicht. Außerdem stehen wir bei unserem Rundgang plötzlich vor einem Lokal, das mit einem großen „Paulaner“-Schild wirbt und Karl bekommt  hier, zum ersten Mal seit Las Vegas, wieder einmal ein Weißbier, das er sichtlich genießt. Was es nicht alles gibt mitten in Honduras! Wir bleiben dann noch etwas länger in dem symphatischen Städtchen, nicht nur weil es hier kühl ist, sondern auch einfach gemütlich. Gleich gegenüber unseres Standplatzes gibt es ein kleines Café mit wlan wo ich an meinem Blog schreibe, Karl repariert derweil alles mögliche, was schon wieder kaputt ist, wie z.B. den
hier, zum ersten Mal seit Las Vegas, wieder einmal ein Weißbier, das er sichtlich genießt. Was es nicht alles gibt mitten in Honduras! Wir bleiben dann noch etwas länger in dem symphatischen Städtchen, nicht nur weil es hier kühl ist, sondern auch einfach gemütlich. Gleich gegenüber unseres Standplatzes gibt es ein kleines Café mit wlan wo ich an meinem Blog schreibe, Karl repariert derweil alles mögliche, was schon wieder kaputt ist, wie z.B. den  USB-Stecker auf meiner Bettseite, bei dem es wieder einmal die Kabel „zerschüttelt“ hat, was ja echt kein
USB-Stecker auf meiner Bettseite, bei dem es wieder einmal die Kabel „zerschüttelt“ hat, was ja echt kein  Wunder ist, bei
Wunder ist, bei den ständigen Holperstrecken auf denen wir uns fortbewegen. Bevor wir „La Esperanza“ dann wieder verlassen, besuchen wir noch die „Banos publicos El Quiscamote“, das sind Quellen die von der Stadt vor langer Zeit gefasst wurden und der Bevölkerung als kostenlose, öffentliche Duschen zur Verfügung stehen. Das ganze sind nur zwei nach Männlein und Weiblein getrennte, nach oben offene Innenhöfe, in die das eiskalte Wasser aus großen Rohren hineinschießt. Ein großer Spaß bei den Temperaturen und zugleich eine der wunderbarsten Duschen seit langem!
den ständigen Holperstrecken auf denen wir uns fortbewegen. Bevor wir „La Esperanza“ dann wieder verlassen, besuchen wir noch die „Banos publicos El Quiscamote“, das sind Quellen die von der Stadt vor langer Zeit gefasst wurden und der Bevölkerung als kostenlose, öffentliche Duschen zur Verfügung stehen. Das ganze sind nur zwei nach Männlein und Weiblein getrennte, nach oben offene Innenhöfe, in die das eiskalte Wasser aus großen Rohren hineinschießt. Ein großer Spaß bei den Temperaturen und zugleich eine der wunderbarsten Duschen seit langem!
Weiter gehts für uns dann noch tiefer hinein ins Hochland. Wir wollen quer über die Berge in Richtung Karibikküste fahren, was uns gleich am Anfang wieder einmal richtig viel Geduld abverlangt. Die Straße ist dermaßen löchrig, dass wir nirgends  mehr als 15 km/h schaffen. Dafür ist fast kein Verkehr vorhanden, was aber hauptsächlich daran liegt, dass sich hier ein Großteil der Menschen die außerhalb der Städte leben, einfach kein Auto leisten kann. Wir übernachten ganz romantisch am „Rio Grande Meiocote“, indem wir nach einer Brücke einfach zum Fluss hinunterfahren und uns dort auf die Schotterbank stellen (es ist Trockenzeit, während der Regenzeit würden wir das über Nacht natürlich nicht riskieren). Ein paar Jugendliche sind hier am Fluss unterwegs, stören sich aber so wenig an uns wie wir uns an ihnen, ein Betrunkener nervt uns eine Zeit lang, labert unverständliches Zeug, zieht dann aber zufrieden ab, nachdem er ein Sandwich und ein Bier von uns bekommen hat. Honduras ist überhaupt das erste Land in Mittelamerika, wo uns öfter Betrunkene am hellichten Tag auffallen. Sie wanken durch die Straßen oder liegen schon am Vormittag auf den Gehsteigen, scheinen aber hier zum Alltagsbild zu gehören, denn niemand scheint sich um sie zu kümmern.
mehr als 15 km/h schaffen. Dafür ist fast kein Verkehr vorhanden, was aber hauptsächlich daran liegt, dass sich hier ein Großteil der Menschen die außerhalb der Städte leben, einfach kein Auto leisten kann. Wir übernachten ganz romantisch am „Rio Grande Meiocote“, indem wir nach einer Brücke einfach zum Fluss hinunterfahren und uns dort auf die Schotterbank stellen (es ist Trockenzeit, während der Regenzeit würden wir das über Nacht natürlich nicht riskieren). Ein paar Jugendliche sind hier am Fluss unterwegs, stören sich aber so wenig an uns wie wir uns an ihnen, ein Betrunkener nervt uns eine Zeit lang, labert unverständliches Zeug, zieht dann aber zufrieden ab, nachdem er ein Sandwich und ein Bier von uns bekommen hat. Honduras ist überhaupt das erste Land in Mittelamerika, wo uns öfter Betrunkene am hellichten Tag auffallen. Sie wanken durch die Straßen oder liegen schon am Vormittag auf den Gehsteigen, scheinen aber hier zum Alltagsbild zu gehören, denn niemand scheint sich um sie zu kümmern.
Unsere Fahrt geht dann am nächsten Tag weiter und wir landen plötzlich mitten im Herzen des Kaffeeanbaus. Bergauf und  bergab grenzt eine kleine Kaffeefarm an die nächste, überall links und rechts
bergab grenzt eine kleine Kaffeefarm an die nächste, überall links und rechts  wachsen die Kaffeepflanzen, meistens beschattet von Bananenstauden und überall passieren wir kleine, versteckte Hütten mit drumherum fast immer jeder Menge über uns staunende Kinder, die,
wachsen die Kaffeepflanzen, meistens beschattet von Bananenstauden und überall passieren wir kleine, versteckte Hütten mit drumherum fast immer jeder Menge über uns staunende Kinder, die, im Gegensatz zu den meisten Erwachsenen, fast immer freundlich winken.Warum die Einheimischen auch hier uns gegenüber eher zurückhaltend und fast ein bisschen abweisend sind, finden wir leider nicht heraus, vielleicht haben sie ja auch keine oder gar schlechte Erfahrungen mit Fremden gemacht. Auffällig ist außerdem, dass jedes noch so
im Gegensatz zu den meisten Erwachsenen, fast immer freundlich winken.Warum die Einheimischen auch hier uns gegenüber eher zurückhaltend und fast ein bisschen abweisend sind, finden wir leider nicht heraus, vielleicht haben sie ja auch keine oder gar schlechte Erfahrungen mit Fremden gemacht. Auffällig ist außerdem, dass jedes noch so  kleine Dorf hier mitten in den Bergen, auch wenn es nur aus wenigen Häusern besteht und weitab jeglicher Zivilisation liegt, auf jeden Fall eines hat: Eine möglichst große Kirche! Als würden sich die Dörfer gegenseitig
kleine Dorf hier mitten in den Bergen, auch wenn es nur aus wenigen Häusern besteht und weitab jeglicher Zivilisation liegt, auf jeden Fall eines hat: Eine möglichst große Kirche! Als würden sich die Dörfer gegenseitig  damit übertreffen wollen. Auch die eine oder andere Schule scheint es zu geben, auf jeden Fall sind die gelben, in den USA längst ausrangierten Schulbusse hier zwischen den Dörfern unterwegs, obwohl es ein offenes
damit übertreffen wollen. Auch die eine oder andere Schule scheint es zu geben, auf jeden Fall sind die gelben, in den USA längst ausrangierten Schulbusse hier zwischen den Dörfern unterwegs, obwohl es ein offenes  Geheimnis ist, dass der Analphabetismus in Honduras ein riesiges Problem ist und die Kinder hier in den Bergen anstatt in die Schule zu gehen oft schon auf den Kaffeeplantagen mit anpacken müssen. Viele Eltern können sich auch weder das Schulgeld noch die Kosten für die
Geheimnis ist, dass der Analphabetismus in Honduras ein riesiges Problem ist und die Kinder hier in den Bergen anstatt in die Schule zu gehen oft schon auf den Kaffeeplantagen mit anpacken müssen. Viele Eltern können sich auch weder das Schulgeld noch die Kosten für die  notwendige Schulkleidung oder die Schulsachen leisten, die hier in Zentralamerika meistens von den Familien selbst bezahlt werden
notwendige Schulkleidung oder die Schulsachen leisten, die hier in Zentralamerika meistens von den Familien selbst bezahlt werden  müssen. Alles hier in den Bergen dreht sich jedenfalls um Kaffee. Überall vor den Häusern und teilweise sogar auf dafür extra abgesperrten, mit Planen ausgelegten Teilen der Schotterstraße, werden Kaffeebohnen in der Sonne getrocknet, man sieht Menschen die schwere Kaffeesäcke zur Straße schleppen und Kaffeebauern mit großen Hüten auf ihren Pferden die Straße entlangreiten.
müssen. Alles hier in den Bergen dreht sich jedenfalls um Kaffee. Überall vor den Häusern und teilweise sogar auf dafür extra abgesperrten, mit Planen ausgelegten Teilen der Schotterstraße, werden Kaffeebohnen in der Sonne getrocknet, man sieht Menschen die schwere Kaffeesäcke zur Straße schleppen und Kaffeebauern mit großen Hüten auf ihren Pferden die Straße entlangreiten.
Immer wieder weht der Duft von frisch gerösteten Kaffeebohnen beim Fenster herein und irgendwann bringt das Karl wohl  auf die Idee, dass er jetzt dringend eine Kaffeepause brauche. Wir halten am Rand des Schotterwegs, steigen aus, Karl geht wie immer rund ums Auto wirft seinen prüfenden Kontrollblick natürlich auch darunter und ich höre ihn sagen: „Das wird ja wohl nicht von uns sein…??“. Oh ja, „es“ ist Öl und davon verlieren wir gerade gar nicht so wenig. Kaffeepause abgesagt, Karl packt schon sein Werkzeug aus und will sich
auf die Idee, dass er jetzt dringend eine Kaffeepause brauche. Wir halten am Rand des Schotterwegs, steigen aus, Karl geht wie immer rund ums Auto wirft seinen prüfenden Kontrollblick natürlich auch darunter und ich höre ihn sagen: „Das wird ja wohl nicht von uns sein…??“. Oh ja, „es“ ist Öl und davon verlieren wir gerade gar nicht so wenig. Kaffeepause abgesagt, Karl packt schon sein Werkzeug aus und will sich  unters Auto legen, da hält ein junger Mann neben uns und fragt ob wir Hilfe brauchen. Karl meint, er müsse erst mal schauen, er schätze aber, dass es nur eine oder mehrere lockere Schrauben an der Ölfilterhalterung
unters Auto legen, da hält ein junger Mann neben uns und fragt ob wir Hilfe brauchen. Karl meint, er müsse erst mal schauen, er schätze aber, dass es nur eine oder mehrere lockere Schrauben an der Ölfilterhalterung  sein können. Der junge Mann meint, nur ca. fünf bis sechs Kilometer weiter gäbe es einen Ort mit einer Werkstatt, ob wir nicht lieber dorthin fahren wollen. Karl stimmt zu, wir finden die Werkstatt ziemlich schnell und dass es bereits Samstagnachmittag ist, macht hier gar nichts, uns wird sofort geholfen. Der Unimog bleibt dazu einfach am
sein können. Der junge Mann meint, nur ca. fünf bis sechs Kilometer weiter gäbe es einen Ort mit einer Werkstatt, ob wir nicht lieber dorthin fahren wollen. Karl stimmt zu, wir finden die Werkstatt ziemlich schnell und dass es bereits Samstagnachmittag ist, macht hier gar nichts, uns wird sofort geholfen. Der Unimog bleibt dazu einfach am Straßenrand stehen, jede Menge interessierte Zuschauer finden sich umgehend rundherum ein, der Chef schnappt sich einen großen Karton, legt sich darauf unters Auto, schickt seine Mitarbeiter im Eiltempo hin und her über die Straße zur Werkstatt, um ihm das jeweils benötigte Werkzeug zu holen und schon nach einer guten halben Stunde ist der Schaden behoben und alle Schrauben sind wieder fest. Er verlangt dafür umgerechnet nur 200 Lempira (8 (!) Euro), was wir natürlich mit einem Trinkgeld aufrunden.
Straßenrand stehen, jede Menge interessierte Zuschauer finden sich umgehend rundherum ein, der Chef schnappt sich einen großen Karton, legt sich darauf unters Auto, schickt seine Mitarbeiter im Eiltempo hin und her über die Straße zur Werkstatt, um ihm das jeweils benötigte Werkzeug zu holen und schon nach einer guten halben Stunde ist der Schaden behoben und alle Schrauben sind wieder fest. Er verlangt dafür umgerechnet nur 200 Lempira (8 (!) Euro), was wir natürlich mit einem Trinkgeld aufrunden.
Nach diesem kurzen und erfolgreichen Boxenstopp übernachten wir nocheinmal mitten in den Bergen und erreichen am  darauffolgende Tag unser nächstes Ziel, den „Lago de Yojoa“. Das riesige Gebiet rund um diesen See ist ein weitgehend unberührtes Naturparadies
darauffolgende Tag unser nächstes Ziel, den „Lago de Yojoa“. Das riesige Gebiet rund um diesen See ist ein weitgehend unberührtes Naturparadies  und beherbergt jede Menge Tiere, unter anderem fast 500 Vogelarten. Ein findiger Amerikaner hat hier vor vielen Jahren eine Lodge mit Brauerei errichtet und sich über die Jahre einen guten Namen als „Backpacker-Ziel“ aufgebaut. Aber nicht nur die meistens jungen Rucksacktouristen sind hier willkommen, auch Overlander wie wir dürfen auf seinem Parkplatz günstig übernachten, worauf gleich bei der Einfahrt ein Schild hinweist. Außer uns steht dort aber wieder einmal nur ein einziges anderes Traveller-Auto und das hat ungarische Kennzeichen. Gleich als wir aussteigen, begrüßen uns die beiden jungen Leute lachend mit den Worten:“Hi, Euch zwei haben wir doch schon in Dawson City gesehen!“ „Eeecht??“ Ja
und beherbergt jede Menge Tiere, unter anderem fast 500 Vogelarten. Ein findiger Amerikaner hat hier vor vielen Jahren eine Lodge mit Brauerei errichtet und sich über die Jahre einen guten Namen als „Backpacker-Ziel“ aufgebaut. Aber nicht nur die meistens jungen Rucksacktouristen sind hier willkommen, auch Overlander wie wir dürfen auf seinem Parkplatz günstig übernachten, worauf gleich bei der Einfahrt ein Schild hinweist. Außer uns steht dort aber wieder einmal nur ein einziges anderes Traveller-Auto und das hat ungarische Kennzeichen. Gleich als wir aussteigen, begrüßen uns die beiden jungen Leute lachend mit den Worten:“Hi, Euch zwei haben wir doch schon in Dawson City gesehen!“ „Eeecht??“ Ja  tatsächlich, jetzt erinnern wir uns auch, dass die beiden einmal eine Zeit lang neben uns auf einem Parkplatz dort ganz oben im kanadischen Norden gestanden sind. – Wie cool ist das, dass wir uns jetzt hier in Honduras wieder treffen! Die „D&D-Brewery-Lodge“ stellt sich dann als unglaublich gemütlicher, symphatischer Platz heraus, sie liegt von außen fast unsichtbar, versteckt unter
tatsächlich, jetzt erinnern wir uns auch, dass die beiden einmal eine Zeit lang neben uns auf einem Parkplatz dort ganz oben im kanadischen Norden gestanden sind. – Wie cool ist das, dass wir uns jetzt hier in Honduras wieder treffen! Die „D&D-Brewery-Lodge“ stellt sich dann als unglaublich gemütlicher, symphatischer Platz heraus, sie liegt von außen fast unsichtbar, versteckt unter den Bäumen des Dschungels, die Mitarbeiter sind extrem freundlich, das Essen ist super und das selbst gebraute Bier nicht schlecht, wenn auch nicht ganz unser Geschmack. Es gibt schnelles wlan, am Abend wird ein Feuer angezündet, um das sich die Gäste gerne in gemütlichen Stühlen gruppieren und wir dürfen
den Bäumen des Dschungels, die Mitarbeiter sind extrem freundlich, das Essen ist super und das selbst gebraute Bier nicht schlecht, wenn auch nicht ganz unser Geschmack. Es gibt schnelles wlan, am Abend wird ein Feuer angezündet, um das sich die Gäste gerne in gemütlichen Stühlen gruppieren und wir dürfen  die sauberen Toiletten und die riesigen „open top“-Duschen mit Warmwasser benützen, in denen man beim Duschen über sich in die Bäume des Dschungels schauen kann, wo die Vögel zwitschern. Eigentlich wollten wir uns hier
die sauberen Toiletten und die riesigen „open top“-Duschen mit Warmwasser benützen, in denen man beim Duschen über sich in die Bäume des Dschungels schauen kann, wo die Vögel zwitschern. Eigentlich wollten wir uns hier  ein Kayak ausleihen und damit ein bisschen über den See und in die Mangroven hineinpaddeln, aber daraus wird nichts. Mir geht es seit einiger Zeit einfach nicht so gut. Alles strengt mich extrem an, wegen jeder Kleinigkeit liegen meine Nerven blank, ich breche oft wegen Nichtigkeiten in Tränen aus – Und der arme Karl muss es dann ausbaden. Wohl eine Art Reisedepression, diagnostiziere ich mir selbst (ein Psychiater oder mein ehemaliger Stammtisch an dem wir uns jahrelang gegenseitig therapiert haben, sind ja leider zwecks umfangreicherer Diagnose nicht in der Nähe…) und ich verordne mir ein paar Tage echtes Nichtstun mit nichts außer essen, trinken, schlafen und ein bisschen schreiben. Karl räumt derweil sein Werkzeug auf und ordnet einmal mehr unsere Ersatzteile neu und ich bin mir sicher, bis wir wieder zu Hause sind, weiß er dann endlich auch genau wo sich was befindet… .
ein Kayak ausleihen und damit ein bisschen über den See und in die Mangroven hineinpaddeln, aber daraus wird nichts. Mir geht es seit einiger Zeit einfach nicht so gut. Alles strengt mich extrem an, wegen jeder Kleinigkeit liegen meine Nerven blank, ich breche oft wegen Nichtigkeiten in Tränen aus – Und der arme Karl muss es dann ausbaden. Wohl eine Art Reisedepression, diagnostiziere ich mir selbst (ein Psychiater oder mein ehemaliger Stammtisch an dem wir uns jahrelang gegenseitig therapiert haben, sind ja leider zwecks umfangreicherer Diagnose nicht in der Nähe…) und ich verordne mir ein paar Tage echtes Nichtstun mit nichts außer essen, trinken, schlafen und ein bisschen schreiben. Karl räumt derweil sein Werkzeug auf und ordnet einmal mehr unsere Ersatzteile neu und ich bin mir sicher, bis wir wieder zu Hause sind, weiß er dann endlich auch genau wo sich was befindet… .
Hier erledigen wir dann auch unsere ersten Anfragen an diverse Reedereien für unsere Verschiffung des Unimogs zwischen Panama und Kolumbien, die notwendig werden wird, da es auf einer Länge von ca. 100 Kilometern mit einem Fahrzeug kein Durchkommen durch den dort wirklich  undurchdringlichen Dschungel, dem „Darién Gap“, gibt (… und gäbe es auch nur eine winzige Chance für uns und den Unimog, würden wir’s ganz sicher probieren,…). Diese „lächerlich kleine Lücke“ auf dem Weg nach Südamerika verursacht bei allen Overlandern das gleiche Kopfweh. Das Fahrzeug muss in Manzanillo in Panama auf ein Frachtschiff, das es in nur ein bis allerhöchstens zwei Tagen ins „praktisch gleich nebenan“ liegende Cartagena in Kolumbien bringt. Da die dortigen Schifffahrtsgesellschaften aber genau wissen, dass den Travellern keine andere Möglichkeit zur Verfügung steht, um nach Südamerika zu kommen, verlangen sie dafür horrende Preise. Die einzige, aber auch nur wenig billigere Alternative wäre eine Verschiffung schon von Mexico aus nach Kolumbien gewesen. Da man dadurch aber auf den Besuch der mittelamerikanischen Länder verzichten hätte müssen, auf die ich mich bei der ganzen Reise am allermeisten gefreut hatte, war das für uns von Anfang an keine Option. Wir stellen also unsere Anfragen schon mit gemischten Gefühlen und es kommt tatsächlich richtig dick: Hat uns die gut zweiwöchige Verschiffung von Antwerpen nach Halifax in Kanada inkl. allen Hafengebühren zwischen 3.500 und 4.000 Euro gekostet, erhalten wir für die kurze Fahrt von Panama nach Kolumbien nur Angebote zwischen 5.500 und 6.000 Euro. Der Unimog ist zu groß um ihn in einem Container zu verschiffen, was, insbesonders gemeinsam mit einem zweiten Fahrzeug, um einiges günstiger wäre, also werden wir wohl in den sauren Apfel beißen müssen,…. .
undurchdringlichen Dschungel, dem „Darién Gap“, gibt (… und gäbe es auch nur eine winzige Chance für uns und den Unimog, würden wir’s ganz sicher probieren,…). Diese „lächerlich kleine Lücke“ auf dem Weg nach Südamerika verursacht bei allen Overlandern das gleiche Kopfweh. Das Fahrzeug muss in Manzanillo in Panama auf ein Frachtschiff, das es in nur ein bis allerhöchstens zwei Tagen ins „praktisch gleich nebenan“ liegende Cartagena in Kolumbien bringt. Da die dortigen Schifffahrtsgesellschaften aber genau wissen, dass den Travellern keine andere Möglichkeit zur Verfügung steht, um nach Südamerika zu kommen, verlangen sie dafür horrende Preise. Die einzige, aber auch nur wenig billigere Alternative wäre eine Verschiffung schon von Mexico aus nach Kolumbien gewesen. Da man dadurch aber auf den Besuch der mittelamerikanischen Länder verzichten hätte müssen, auf die ich mich bei der ganzen Reise am allermeisten gefreut hatte, war das für uns von Anfang an keine Option. Wir stellen also unsere Anfragen schon mit gemischten Gefühlen und es kommt tatsächlich richtig dick: Hat uns die gut zweiwöchige Verschiffung von Antwerpen nach Halifax in Kanada inkl. allen Hafengebühren zwischen 3.500 und 4.000 Euro gekostet, erhalten wir für die kurze Fahrt von Panama nach Kolumbien nur Angebote zwischen 5.500 und 6.000 Euro. Der Unimog ist zu groß um ihn in einem Container zu verschiffen, was, insbesonders gemeinsam mit einem zweiten Fahrzeug, um einiges günstiger wäre, also werden wir wohl in den sauren Apfel beißen müssen,…. .
Nach ein paar Tagen Pause geht es mir wieder besser und wir fahren weiter durch die Berge Richtung Küste, nicht ohne noch  einen Stopp am wunderschönen Wasserfall „Cataratas de Pulhapanzak“
einen Stopp am wunderschönen Wasserfall „Cataratas de Pulhapanzak“  zu machen, der sich, samt einer riesigen Ranch mit vielen Rindern und Pferden, in Privatbesitz
zu machen, der sich, samt einer riesigen Ranch mit vielen Rindern und Pferden, in Privatbesitz befindet, was sich sofort darin äußert, dass die Übernachtung hier teurer ist als sonst, aber es auch auf dem ganzen Gelände plötzlich Mülltonnen gibt und ausnahmsweise kein Stück Plastik irgendwo herumliegt. Wir haben hier einen wundervollen Standplatz, wieder einmal ganz für uns alleine, unter riesigen, alten Bäumen und bekommen am nächsten Tag sogar noch
befindet, was sich sofort darin äußert, dass die Übernachtung hier teurer ist als sonst, aber es auch auf dem ganzen Gelände plötzlich Mülltonnen gibt und ausnahmsweise kein Stück Plastik irgendwo herumliegt. Wir haben hier einen wundervollen Standplatz, wieder einmal ganz für uns alleine, unter riesigen, alten Bäumen und bekommen am nächsten Tag sogar noch  eine ganz
eine ganz  private Reitvorführung.
private Reitvorführung.
Dagegen sehen wir auf der anschließenden Strecke eine völlig neue, wohl typisch honduranische Art der Müllbewältigung. Es werden hier nämlich ganze Straßenböschungen samt dem in rauen Mengen darauf befindlichen Müll, über eine Länge von mehreren hundert Metern einfach angezündet, was die Straße samt Anwohnern in dicke Rauchwolken hüllt, hier aber völlig normal zu sein scheint. Bereits in Küstennähe durchqueren wir dann noch riesige Flächen von Monokultur, wie Zuckerrohr, Sojabohnenfelder und Palmölhaine, denen in den letzten  Jahrzehnten fast 90 % des honduranischen Regenwalds zum Opfer gefallen sind. Besonders die Flächen für Ölpalmen scheinen endlos zu
Jahrzehnten fast 90 % des honduranischen Regenwalds zum Opfer gefallen sind. Besonders die Flächen für Ölpalmen scheinen endlos zu  sein und wir sehen immer wieder riesige LKWs, hoch beladen mit Palmölfrüchten, die diese bei stinkenden Fabriken abladen und woraus dann das überall in unserem Alltag gegenwärtige Palmöl hergestellt wird. Viele Bauern in Honduras haben ja gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf den Anbau
sein und wir sehen immer wieder riesige LKWs, hoch beladen mit Palmölfrüchten, die diese bei stinkenden Fabriken abladen und woraus dann das überall in unserem Alltag gegenwärtige Palmöl hergestellt wird. Viele Bauern in Honduras haben ja gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf den Anbau  von Bananen gesetzt, als sie dahinterkamen, wie rasch die Früchte hier in diesem Klima wachsen. Das Ergebnis war aber
von Bananen gesetzt, als sie dahinterkamen, wie rasch die Früchte hier in diesem Klima wachsen. Das Ergebnis war aber  nur, dass sie sich dadurch vielfach völlig in die Hände von amerikanischen „Bananeniganten“ begaben und erst als es bereits viel zu spät für einen Ausstieg war, erfahren mussten, dass der Bananenanbau die Böden ganz extrem auslaugt und die Flächen zwischendurch brach liegen und sich erholen müssen. Als dadurch Honduras als Bananenlieferant für die amerikanischen Firmen immer weniger rentabel wurde, kozentrierten sich diese mehr auf z.B. Costa Rica und ließen sie die honduranischen Bauern eiskalt fallen. Natürlich ist es denen daher nicht zu verdenken, dass sie sich daraufhin für ihre Böden andere Anbaumöglichkeiten suchten, auch wenn es natürlich eine Katastrophe ist, dass dafür der Regenwald im Land fast zur Gänze sein Leben lassen musste. Ist uns doch allen das Hemd näher als der Rock!
nur, dass sie sich dadurch vielfach völlig in die Hände von amerikanischen „Bananeniganten“ begaben und erst als es bereits viel zu spät für einen Ausstieg war, erfahren mussten, dass der Bananenanbau die Böden ganz extrem auslaugt und die Flächen zwischendurch brach liegen und sich erholen müssen. Als dadurch Honduras als Bananenlieferant für die amerikanischen Firmen immer weniger rentabel wurde, kozentrierten sich diese mehr auf z.B. Costa Rica und ließen sie die honduranischen Bauern eiskalt fallen. Natürlich ist es denen daher nicht zu verdenken, dass sie sich daraufhin für ihre Böden andere Anbaumöglichkeiten suchten, auch wenn es natürlich eine Katastrophe ist, dass dafür der Regenwald im Land fast zur Gänze sein Leben lassen musste. Ist uns doch allen das Hemd näher als der Rock!
Die Ostküste oder „Mehr Karibik geht wirklich nicht!“
Über eine weitere Schotterstraße erreichen wir dann endlich das karibische Meer und fahren hinaus auf eine enge Halbinsel, die sich entlang des Festlandes wie eine Nadel ins Meer hineinstreckt und daher auf der einen Seite eine Lagune bildet und auf der anderen Seite nur aus frei zugänglichen, unverbauten Bilderbuch-Palmenstränden besteht. Nichts außer ein kleines  Garifuna-Dorf namens „Miami“ gibt es hier ganz an der Spitze, das aber nur aus weit auseinanderliegenden Hütten besteht. Leider haben wir wieder einmal die Zeit unterschätzt und wir schaffen es gerade nicht mehr bevor es finster wird einen Übernachtungsplatz zu finden. In der Dunkelheit zwischen
Garifuna-Dorf namens „Miami“ gibt es hier ganz an der Spitze, das aber nur aus weit auseinanderliegenden Hütten besteht. Leider haben wir wieder einmal die Zeit unterschätzt und wir schaffen es gerade nicht mehr bevor es finster wird einen Übernachtungsplatz zu finden. In der Dunkelheit zwischen  den Palmen ans Meer heranzufahren ist unmöglich und wir probieren unser Glück daher neben einem nach einem Restaurant aussehenden Gebäude. Wir parken im Dunkeln halbwegs ein, schon kommt ein extrem unfreundlich dreinschauender Mann mit ein paar Kindern im Schlepptau und nimmt Aufstellung neben dem Unimog. Ich steige aus und frage ihn höflich, ob wir hier übernachten dürfen und er schaut noch unfreundlicher und knurrt etwas von 500 (!) Lempira (20 Euro), Ich glaube ich habe mich verhört und frage noch zweimal nach. Wir bieten ihm dann 100 Lempira (4 Euro) an, er bleibt aber stur bei seiner Forderung, wahrscheinlich glaubt er, dass wir um diese Zeit sowieso nichts anderes mehr finden würden. Wir sagen ihm aber, dass uns das viel zu teuer ist, starten den Unimog und fahren zurück in die Dunkelheit des Hauptwegs und darauf langsam weiter. Da schickt er uns schon seine Kinder hinterher, die uns ausrichten, es würde jetzt auch billiger
den Palmen ans Meer heranzufahren ist unmöglich und wir probieren unser Glück daher neben einem nach einem Restaurant aussehenden Gebäude. Wir parken im Dunkeln halbwegs ein, schon kommt ein extrem unfreundlich dreinschauender Mann mit ein paar Kindern im Schlepptau und nimmt Aufstellung neben dem Unimog. Ich steige aus und frage ihn höflich, ob wir hier übernachten dürfen und er schaut noch unfreundlicher und knurrt etwas von 500 (!) Lempira (20 Euro), Ich glaube ich habe mich verhört und frage noch zweimal nach. Wir bieten ihm dann 100 Lempira (4 Euro) an, er bleibt aber stur bei seiner Forderung, wahrscheinlich glaubt er, dass wir um diese Zeit sowieso nichts anderes mehr finden würden. Wir sagen ihm aber, dass uns das viel zu teuer ist, starten den Unimog und fahren zurück in die Dunkelheit des Hauptwegs und darauf langsam weiter. Da schickt er uns schon seine Kinder hinterher, die uns ausrichten, es würde jetzt auch billiger gehen, so 200 Lempira wären auch ok. Im gleichen Moment kommt aber ein junger Mann, wohl ein Nachbar der das ganze mitbekommen
gehen, so 200 Lempira wären auch ok. Im gleichen Moment kommt aber ein junger Mann, wohl ein Nachbar der das ganze mitbekommen  hat, aus der Dunkelheit, steigt bei Karl aufs Trittbrett und sagt uns, wir sollen nur ein paar hundert Meter bis zu
hat, aus der Dunkelheit, steigt bei Karl aufs Trittbrett und sagt uns, wir sollen nur ein paar hundert Meter bis zu seinem Haus zurückfahren, denn natürlich dürften wir auf seinem Grundstück kostenlos übernachten. So verschieden wie überall auf der Welt sind halt auch die Ansichten der Menschen in Honduras, was den Umgang mit Gästen betrifft. Wir freuen uns natürlich gerade in dieser Situation besonders über diese Gastfreundschaft, bedanken uns am nächsten Morgen mit ein paar
seinem Haus zurückfahren, denn natürlich dürften wir auf seinem Grundstück kostenlos übernachten. So verschieden wie überall auf der Welt sind halt auch die Ansichten der Menschen in Honduras, was den Umgang mit Gästen betrifft. Wir freuen uns natürlich gerade in dieser Situation besonders über diese Gastfreundschaft, bedanken uns am nächsten Morgen mit ein paar  Süßigkeiten für die
Süßigkeiten für die Kinder bei der netten Familie und suchen uns dann nur ein paar Kilometer weiter und nun bei Tageslicht wieder ohne Probleme, den für uns schönsten Platz am Palmenstrand aus. Neben einer winzigen
Kinder bei der netten Familie und suchen uns dann nur ein paar Kilometer weiter und nun bei Tageslicht wieder ohne Probleme, den für uns schönsten Platz am Palmenstrand aus. Neben einer winzigen Hütte liegen ein paar schattige Palapas, die freundliche Eigentümerin stimmt sofort zu, als wir sie um Erlaubnis fragen, ein paar Tage hier zu übernachten. Sie verlangt nichts dafür, bietet aber köstlichen, gegrillten Fisch und
Hütte liegen ein paar schattige Palapas, die freundliche Eigentümerin stimmt sofort zu, als wir sie um Erlaubnis fragen, ein paar Tage hier zu übernachten. Sie verlangt nichts dafür, bietet aber köstlichen, gegrillten Fisch und  Garnelen an, die sie in ihrer rustikalen“Outdoor-Küche“ frisch zubereitet und natürlich kaltes „Salva Vida“. Selbstverständlich revanchieren wir uns bei ihr für den paradiesischen Gratis-Standplatz indem wir in den nächsten Tagen auch bei ihr essen. Zusätzlich hat sie sehr gemütliche Hängematten unter ihren schattigen Palapas aufgehängt, in denen wir immer nach dem Essen eine
Garnelen an, die sie in ihrer rustikalen“Outdoor-Küche“ frisch zubereitet und natürlich kaltes „Salva Vida“. Selbstverständlich revanchieren wir uns bei ihr für den paradiesischen Gratis-Standplatz indem wir in den nächsten Tagen auch bei ihr essen. Zusätzlich hat sie sehr gemütliche Hängematten unter ihren schattigen Palapas aufgehängt, in denen wir immer nach dem Essen eine  verdiente Siesta halten. Wir erleben wieder einmal
verdiente Siesta halten. Wir erleben wieder einmal die traumhaftesten Sonnenuntergänge, obwohl man diesmal nicht genau sagen kann, ob nicht die Sonnenaufgänge die wir vom Bett aus durchs offene Fenster genießen, hier mindestens genauso schön sind. Das ist wieder einmal so ein Platz den man möglichst lange nicht verlassen möchte…!
die traumhaftesten Sonnenuntergänge, obwohl man diesmal nicht genau sagen kann, ob nicht die Sonnenaufgänge die wir vom Bett aus durchs offene Fenster genießen, hier mindestens genauso schön sind. Das ist wieder einmal so ein Platz den man möglichst lange nicht verlassen möchte…!
So viel Zeit wie wir gerne möchten haben wir aber wie immer nicht, nach ein paar Tagen faulem Beach-Life an der Karibikküste gehts weiter Richtung Osten. Irgendwie haben wir jetzt wieder einmal Lust auf etwas Adrenalin und wir fahren zum „Rio Cangrejal“,  angeblich einem der besten Flüsse in ganz Zentralamerika für
angeblich einem der besten Flüsse in ganz Zentralamerika für „River-Rafting“, also Wildwasser-Schlauchbootfahren. Ja, das wäre der Rio Cangrejal auch ganz sicher, er schlängelt sich vor der unglaublich schönen Kulisse des honduranischen Dschungels durch die Berge und alles wäre super, wenn …. ja wenn wir nicht noch in der Trockenzeit wären, die zwar langsam zu Ende geht aber trotzdem ist der Wasserstand einfach noch viel zu niedrig zum Raften.. Wir befürchten das Dilemma schon als wir auf einer staubigen Schotterstraße entlang des Flusses, der wirklich nur ein trauriges Rinnsal ist, in die Berge hinauffahren. Alle Lodges die Rafting anbieten sind dann auch noch geschlossen und so müssen wir unseren schönen Plan diesmal leider aufgeben und das Wildwasser-Abenteuer halt auf später verschieben.
„River-Rafting“, also Wildwasser-Schlauchbootfahren. Ja, das wäre der Rio Cangrejal auch ganz sicher, er schlängelt sich vor der unglaublich schönen Kulisse des honduranischen Dschungels durch die Berge und alles wäre super, wenn …. ja wenn wir nicht noch in der Trockenzeit wären, die zwar langsam zu Ende geht aber trotzdem ist der Wasserstand einfach noch viel zu niedrig zum Raften.. Wir befürchten das Dilemma schon als wir auf einer staubigen Schotterstraße entlang des Flusses, der wirklich nur ein trauriges Rinnsal ist, in die Berge hinauffahren. Alle Lodges die Rafting anbieten sind dann auch noch geschlossen und so müssen wir unseren schönen Plan diesmal leider aufgeben und das Wildwasser-Abenteuer halt auf später verschieben.
Immer weiter die Küste entlang erreichen wir dann den ziemlich heruntergekommenen Garifuna-Ort „Sambo-Creek“, von wo aus kleine Boote auf die nur ca. 15 Kilometer entfernten „Cayos Cochinos“, die „Schweineinseln“ starten, angeblich ein kleines Paradies mit Palmen und Strand. Ich, die ich immer Ausbrüche aus dem Reisealltag suche, bin dafür, dass wir einen Tagesausflug dorthin machen, umso mehr als nun schon nichts aus der Raftingtour geworden ist, aber Karl zieht nicht  wirklich mit und irgendwie hat er ja auch recht, die Karibikküste ist hier am Festland so einzigartig schön, warum noch zusätzliches Geld ausgeben, nur um auf einer Insel das Gleiche zu haben. Nach einer weiteren Übernachtung am Meer, zur Abwechslung mal mitten zwischen einer Kuhherde, gehts
wirklich mit und irgendwie hat er ja auch recht, die Karibikküste ist hier am Festland so einzigartig schön, warum noch zusätzliches Geld ausgeben, nur um auf einer Insel das Gleiche zu haben. Nach einer weiteren Übernachtung am Meer, zur Abwechslung mal mitten zwischen einer Kuhherde, gehts  darum dann auch gleich wieder weiter. Leider erleiden wir an diesem Tag einen herben Verlust. Wir haben nämlich vor der Abfahrt vergessen, unseren „Schweizer Wassersack“ vom Dach des Unimogs zu nehmen, wo der große,
darum dann auch gleich wieder weiter. Leider erleiden wir an diesem Tag einen herben Verlust. Wir haben nämlich vor der Abfahrt vergessen, unseren „Schweizer Wassersack“ vom Dach des Unimogs zu nehmen, wo der große,  schwarze, mit Wasser gefüllte Gummisack uns immer, zusätzlich zu unserer normalen Dusche, als Warmwasserspeicher gedient hat, was ideal war, um sich nach dem Schwimmen im Meer kurz das Salz und den Sand abzuduschen. Dafür hat Karl vor der Abreise extra noch einen Duschschlauch mit einem Gardena-Anschluss darauf montiert, was gar nicht so einfach war. Mitten unter der Fahrt fällt uns unser Versäumnis siedendheiß ein, aber natürlich ist es bereits viel zu spät, der Sack samt Dusche ist längst vom Dach gefallen und mit Sicherheit umgehend in einer honduranischen Familie gelandet, die sich hoffentlich jetzt über eine Dusche freut und ihn in Ehren halten wird. Wir haben zwar irgendwo tief im Bauch des Unimogs noch einen zweiten Wassersack, aber mal schauen, ob wir jemanden finden, der uns diesen wieder so komfortabel mit einem Duschschlauch ausstatten kann… .
schwarze, mit Wasser gefüllte Gummisack uns immer, zusätzlich zu unserer normalen Dusche, als Warmwasserspeicher gedient hat, was ideal war, um sich nach dem Schwimmen im Meer kurz das Salz und den Sand abzuduschen. Dafür hat Karl vor der Abreise extra noch einen Duschschlauch mit einem Gardena-Anschluss darauf montiert, was gar nicht so einfach war. Mitten unter der Fahrt fällt uns unser Versäumnis siedendheiß ein, aber natürlich ist es bereits viel zu spät, der Sack samt Dusche ist längst vom Dach gefallen und mit Sicherheit umgehend in einer honduranischen Familie gelandet, die sich hoffentlich jetzt über eine Dusche freut und ihn in Ehren halten wird. Wir haben zwar irgendwo tief im Bauch des Unimogs noch einen zweiten Wassersack, aber mal schauen, ob wir jemanden finden, der uns diesen wieder so komfortabel mit einem Duschschlauch ausstatten kann… .
Als äußerstes Ziel an der Ostküste haben wir uns die Hafenstadt Trujillo gesetzt, die ein bisschen als Außenstützpunkt von Honduras gilt, weil sich dahinter bis hin zur nicaraguanischen Grenze dann nichts mehr als eine riesige, einsame Wildnis, genannt „La Moskitia“ befindet, benannt jedoch nicht nach dem blutsaugenden Insekt, sondern nach den hier noch lebenden Nachfahren der Ureinwohner, dem Volk der „Miskito“. Es ist eine der letzten, zusammenhängenden Gebiete bestehend aus Dschungel, Feuchtgebieten und Savannen und wird daher oft als „Amazonasbecken Zentralamerikas“ bezeichnet. Befestigte Straßen gibt es dort keine, vieles ist auch Sumpfgebiet und nur per Boot erreichbar. Das alles liegt also hinter „Trujillo“, aber bis dorthin müssen wir jetzt erst einmal kommen. Wir kämpfen langsam ein bissschen mit der Weite von Honduras, dem zweitgrößten Land Mittelamerikas, umso mehr als man sich auf den wirklich schlechten Straßen in diesem Land gefühlt ständig nur im Schritttempo weiterbewegt, bzw. zugegebenermaßen haben wir in den letzten Wochen an den vielen, wunderbaren Plätzen ja auch wirklich etwas getrödelt. Die Zeit die uns laut unserem „CA-4-Visum“ noch bleibt und die ja dann auch noch für Nicaragua reichen muss, wird langsam knapp.
Die Dschungeltour oder „Abgrund mit Abzocke“
Wir beschließen also, nur mehr das letzte Stück bis nach „Santa Fe“, einem kleinen Strandort kurz vor Trujillo, direkt die Küste entlang zu fahren und dann von dort in einem weiten Bogen durch die Einsamkeit der „Moskitia“ weiter Richtung  Grenze. Dass dieses letzte Stück „Straße“ bei Google-Maps nicht aufscheint und in unserer Straßenkarte wieder einmal nur strichliert angezeigt wird, stört uns dabei nicht, wir setzen auf unser bewährtes Mittel: Frag die Einheimischen. In einem der letzten winzigen Ortschaften die Google noch anzeigt, befrage ich daher als erstes einen Polizisten. Ich halte ihm die Straßenkarte unter die Nase und frage ihn, ob diese strichlierte Linie eine mit unserem Unimog befahrbare Straße ist. Er schaut sich die Karte an, ich glaube, er hat noch nicht viele vorher gesehen und er meint daraufhin: „Ja, kein Problem“. Ich sage ihm dann, dass „Google-Maps“hier keine Straße anzeigt und zeige ihm dazu die Karte auf dem Handy. Daraufhin ändert er schlagartig seine Meinung und sagt jetzt: „Nein, mir fällt gerade ein, da gibt es keine Straße“. Ich bedanke mich höflich und bin so gescheit wie vorher. Karl kommt inzwischen von seinem Einkauf beim Metzger zurück und ich überlasse ihm die Entscheidung ob wir weiterfahren sollen oder nicht. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl und will bei dieser Sache nicht am Schluss alleine den „Schwarzen Peter“ haben. Karl meint aber auch, wir sollen weiterfahren, „So schlimm wird’s schon nicht werden…“ .
Grenze. Dass dieses letzte Stück „Straße“ bei Google-Maps nicht aufscheint und in unserer Straßenkarte wieder einmal nur strichliert angezeigt wird, stört uns dabei nicht, wir setzen auf unser bewährtes Mittel: Frag die Einheimischen. In einem der letzten winzigen Ortschaften die Google noch anzeigt, befrage ich daher als erstes einen Polizisten. Ich halte ihm die Straßenkarte unter die Nase und frage ihn, ob diese strichlierte Linie eine mit unserem Unimog befahrbare Straße ist. Er schaut sich die Karte an, ich glaube, er hat noch nicht viele vorher gesehen und er meint daraufhin: „Ja, kein Problem“. Ich sage ihm dann, dass „Google-Maps“hier keine Straße anzeigt und zeige ihm dazu die Karte auf dem Handy. Daraufhin ändert er schlagartig seine Meinung und sagt jetzt: „Nein, mir fällt gerade ein, da gibt es keine Straße“. Ich bedanke mich höflich und bin so gescheit wie vorher. Karl kommt inzwischen von seinem Einkauf beim Metzger zurück und ich überlasse ihm die Entscheidung ob wir weiterfahren sollen oder nicht. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl und will bei dieser Sache nicht am Schluss alleine den „Schwarzen Peter“ haben. Karl meint aber auch, wir sollen weiterfahren, „So schlimm wird’s schon nicht werden…“ . Die Schotterstraße ist dann auch weiterhin recht gut, wir überqueren die ersten Flüsse die keine Brücken mehr haben und in denen gerade ein paar Leute ihre Autos und ein paar Busfahrer ihre gelben Schulbusse waschen (das mach einer bei uns!). Ich frage hier nocheinmal einen Mann was er zum Thema Straße nach „Santa Fe“ meint.
Die Schotterstraße ist dann auch weiterhin recht gut, wir überqueren die ersten Flüsse die keine Brücken mehr haben und in denen gerade ein paar Leute ihre Autos und ein paar Busfahrer ihre gelben Schulbusse waschen (das mach einer bei uns!). Ich frage hier nocheinmal einen Mann was er zum Thema Straße nach „Santa Fe“ meint.  Er sagt mir, er wisse es zwar nicht genau, aber er ist sich ziemlich sicher, dass es einen Weg dorthin gibt, allerdings kenne er nur Leute die diesen mit Motocross-Motorrädern benützen,… – Na bravo! Als wir das letzte Dorf erreichen, wo laut Google die Straße endet, tut sie das im ersten Moment auch bzw. finden wir erstmal keinen Weg der von dort irgendwohin weiterführt. Ein paar Mal
Er sagt mir, er wisse es zwar nicht genau, aber er ist sich ziemlich sicher, dass es einen Weg dorthin gibt, allerdings kenne er nur Leute die diesen mit Motocross-Motorrädern benützen,… – Na bravo! Als wir das letzte Dorf erreichen, wo laut Google die Straße endet, tut sie das im ersten Moment auch bzw. finden wir erstmal keinen Weg der von dort irgendwohin weiterführt. Ein paar Mal  schickt man uns in die falsche Richtung, dann frage ich noch einmal einen jungen Mann, der uns dann die richtige Straße zeigt und uns zusätzlich mit der Information überrascht, dass er kein Problem darin sehe, dass wir mit dem Unimog auf diesem Weg bis nach „Santa Fe“ fahren. Na dann,…! Kaum haben wir das Dorf verlassen, geht’s aber gleich richtig los. Der enge Weg, gerade
schickt man uns in die falsche Richtung, dann frage ich noch einmal einen jungen Mann, der uns dann die richtige Straße zeigt und uns zusätzlich mit der Information überrascht, dass er kein Problem darin sehe, dass wir mit dem Unimog auf diesem Weg bis nach „Santa Fe“ fahren. Na dann,…! Kaum haben wir das Dorf verlassen, geht’s aber gleich richtig los. Der enge Weg, gerade mal so breit wie der Unimog, führt abwechselnd steil bergauf mit wunderschönen Ausblicken über das karibische Meer und im nächsten Moment über roten, lehmigen, rutschigen Untergrund (es hat die ganze letzte Nacht geregnet) wieder steil bergab und hinein in den Dschungel, der uns links und rechts so nahe kommt, dass man meint es gäbe kein Durchkommen. Ich muss das Fenster schließen, weil ich sonst ständig Äste, Blätter und alle Arten von
mal so breit wie der Unimog, führt abwechselnd steil bergauf mit wunderschönen Ausblicken über das karibische Meer und im nächsten Moment über roten, lehmigen, rutschigen Untergrund (es hat die ganze letzte Nacht geregnet) wieder steil bergab und hinein in den Dschungel, der uns links und rechts so nahe kommt, dass man meint es gäbe kein Durchkommen. Ich muss das Fenster schließen, weil ich sonst ständig Äste, Blätter und alle Arten von  Käfern im Gesicht und im Führerhaus habe. Gott sei Dank hat der Unimog vor der Abreise noch eine extra harte Speziallackierung bekommen, denn sonst wären uns tiefe Schrammen im Lack sicher. Mehrmals müssen wir Flüsse durchqueren und dabei um große, darin liegende Steine herumfahren. Immer wieder ist der ohnedies enge Weg zusätzlich durch Schlamm, abgebrochene Ränder oder hereinragende Baumstämme sowie
Käfern im Gesicht und im Führerhaus habe. Gott sei Dank hat der Unimog vor der Abreise noch eine extra harte Speziallackierung bekommen, denn sonst wären uns tiefe Schrammen im Lack sicher. Mehrmals müssen wir Flüsse durchqueren und dabei um große, darin liegende Steine herumfahren. Immer wieder ist der ohnedies enge Weg zusätzlich durch Schlamm, abgebrochene Ränder oder hereinragende Baumstämme sowie  überhängende Böschungen nahezu unpassierbar, sodass wir oft mehrere Versuche brauchen, um diese Engstellen schließlich Zentimeter für Zentimeter zu überwinden. Ob ich Karl dabei als „Einweiserin“ von außen immer eine echte Hilfe bin, oder ob er mich damit nur aus dem Führerhaus haben will um sich konzentrieren zu können, weiß ich nicht so genau. Meine Angst, dass der Unimog hier mitten im Dschungel, weit abseits der nächsten Bergefirma, in einen Graben kippt, ist oft einfach zu groß, als dass ich die jeweilige Situation realistisch einschätzen könnte. Ganz langsam kommen wir Kilometer um Kilometer voran. Einmal müssen sogar zu niedrig über dem Weg hängende Wasserleitungen,
überhängende Böschungen nahezu unpassierbar, sodass wir oft mehrere Versuche brauchen, um diese Engstellen schließlich Zentimeter für Zentimeter zu überwinden. Ob ich Karl dabei als „Einweiserin“ von außen immer eine echte Hilfe bin, oder ob er mich damit nur aus dem Führerhaus haben will um sich konzentrieren zu können, weiß ich nicht so genau. Meine Angst, dass der Unimog hier mitten im Dschungel, weit abseits der nächsten Bergefirma, in einen Graben kippt, ist oft einfach zu groß, als dass ich die jeweilige Situation realistisch einschätzen könnte. Ganz langsam kommen wir Kilometer um Kilometer voran. Einmal müssen sogar zu niedrig über dem Weg hängende Wasserleitungen,  die zu einem Haus mitten im Dschungel führen, für uns angehoben werden. Man wirft uns verwunderte Blicke zu, als hätten die Einheimischen keine Idee, wo diese zwei Fremden mit dem riesigen Auto auf dem viel zu schmalen Weg wohl hinwollen. Die Fahrt ist ohne Übertreibung echte Schwerstarbeit, besonders für Karl, der hier wieder einmal alles geben muss und was unser Unimog hierbei leistet ist einfach nur sensationell. Nach ca. zwei Stunden, wir haben noch nicht ganz zwei Drittel des Weges geschafft, kommen wir an eine Engstelle die mir wirklich echte Angst macht. Ganz eng vorbei an einem Felsen tastet sich der Unimog und trotzdem ist der Radius für das linke Hinterrad an der abfallenden Seite einfach zu eng, sodass ein Teil
die zu einem Haus mitten im Dschungel führen, für uns angehoben werden. Man wirft uns verwunderte Blicke zu, als hätten die Einheimischen keine Idee, wo diese zwei Fremden mit dem riesigen Auto auf dem viel zu schmalen Weg wohl hinwollen. Die Fahrt ist ohne Übertreibung echte Schwerstarbeit, besonders für Karl, der hier wieder einmal alles geben muss und was unser Unimog hierbei leistet ist einfach nur sensationell. Nach ca. zwei Stunden, wir haben noch nicht ganz zwei Drittel des Weges geschafft, kommen wir an eine Engstelle die mir wirklich echte Angst macht. Ganz eng vorbei an einem Felsen tastet sich der Unimog und trotzdem ist der Radius für das linke Hinterrad an der abfallenden Seite einfach zu eng, sodass ein Teil  des Reifens beim Passieren über dem Abgrund schwebt. Ich kann gar nicht hinschauen, bin danach fix und fertig (und neeeiiinn, es gibt ganz sicher kein Foto davon,…!), versuche gerade meine Nerven wieder zu beruhigen, da taucht schon hundert Meter weiter die nächste Kurve mit der nächsten Engstelle auf, diesmal jedoch – das muss auch Karl zugeben – wirklich unpassierbar für uns. Der Weg ist hier wohl schon mehrmals weggebrochen und es wurden daher von den Einheimischen zur Verbreiterung große, mit Erde befüllte Säcke entlang der Abbruchkante „eingearbeitet“. Leider ist aber daneben der Abbruch noch weiter fortgeschritten und der Weg ist hier höchstens noch zwei Meter breit. Die Böschung auf der Innenseite hängt zusätzlich über und es ragen dort außerdem noch dicke Äste in die Fahrbahn herein. Wir steigen beide aus und gehen ratlos und deprimiert von einer Seite der Kurve zur anderen – Keine Chance, das ist uns klar, es fehlen mindestens 30 cm um überhaupt an ein, auch dann noch unsicheres, Vorbeikommen zu denken – Das heißt die ganze Schufterei um bis hierher zu kommen war umsonst.
des Reifens beim Passieren über dem Abgrund schwebt. Ich kann gar nicht hinschauen, bin danach fix und fertig (und neeeiiinn, es gibt ganz sicher kein Foto davon,…!), versuche gerade meine Nerven wieder zu beruhigen, da taucht schon hundert Meter weiter die nächste Kurve mit der nächsten Engstelle auf, diesmal jedoch – das muss auch Karl zugeben – wirklich unpassierbar für uns. Der Weg ist hier wohl schon mehrmals weggebrochen und es wurden daher von den Einheimischen zur Verbreiterung große, mit Erde befüllte Säcke entlang der Abbruchkante „eingearbeitet“. Leider ist aber daneben der Abbruch noch weiter fortgeschritten und der Weg ist hier höchstens noch zwei Meter breit. Die Böschung auf der Innenseite hängt zusätzlich über und es ragen dort außerdem noch dicke Äste in die Fahrbahn herein. Wir steigen beide aus und gehen ratlos und deprimiert von einer Seite der Kurve zur anderen – Keine Chance, das ist uns klar, es fehlen mindestens 30 cm um überhaupt an ein, auch dann noch unsicheres, Vorbeikommen zu denken – Das heißt die ganze Schufterei um bis hierher zu kommen war umsonst. Wir müssen umkehren und wenn ich nur an die vielen Engstellen denke, die wir mit so viel Mühe und meiner Meinung nach auch oft mit viel Glück passiert haben, wird mir schon bei dem Gedanken an eine Rückfahrt ganz schlecht. Ein paar Kinder beobachten uns, wie wir so ratlos dastehen und wahrscheinlich sind sie es auch, die dann die Nachricht zu den nicht weit entfernten Einheimischen-Hütten bringen, dass hier ein LKW vor der Kurve steht, denn wenig später tauchen auch ein paar junge Männer auf. Sie schauen sich die Situation einige Zeit lang an, kommen dann näher und machen uns folgenden Vorschlag: Sie würden nach Hause gehen um Werkzeug zu holen, damit könnten sie die Böschung abgraben und dieses Material in weitere Säcke füllen, mit denen sie dann den Weg so verbreitern, dass wir um die Engstelle herumkommen. Dafür velangen sie 1.000 Lempira (40 Euro). OK, … wir überlegen, … das Geld ist nicht das große Problem, der Betrag ja nicht so hoch…, aber was wenn auf dem Rest des Weges noch mehr solcher Stellen auf uns warten? Wir fragen deshalb genau nach, wie der Zustand des Wegs von hier bis nach Santa Fe ist. Sie versichern uns mehrmals, dass dies hier die einzige, die letzte für uns und den Unimog unpassierbare Stelle sei und dass der Weg ab hier bis nach Santa Fe viel besser werden würde. „No problema, seguro!“ Da wir natürlich an diesem Punkt nicht wirklich Lust haben umzudrehen, sagen wir zu, sie marschieren daraufhin
Wir müssen umkehren und wenn ich nur an die vielen Engstellen denke, die wir mit so viel Mühe und meiner Meinung nach auch oft mit viel Glück passiert haben, wird mir schon bei dem Gedanken an eine Rückfahrt ganz schlecht. Ein paar Kinder beobachten uns, wie wir so ratlos dastehen und wahrscheinlich sind sie es auch, die dann die Nachricht zu den nicht weit entfernten Einheimischen-Hütten bringen, dass hier ein LKW vor der Kurve steht, denn wenig später tauchen auch ein paar junge Männer auf. Sie schauen sich die Situation einige Zeit lang an, kommen dann näher und machen uns folgenden Vorschlag: Sie würden nach Hause gehen um Werkzeug zu holen, damit könnten sie die Böschung abgraben und dieses Material in weitere Säcke füllen, mit denen sie dann den Weg so verbreitern, dass wir um die Engstelle herumkommen. Dafür velangen sie 1.000 Lempira (40 Euro). OK, … wir überlegen, … das Geld ist nicht das große Problem, der Betrag ja nicht so hoch…, aber was wenn auf dem Rest des Weges noch mehr solcher Stellen auf uns warten? Wir fragen deshalb genau nach, wie der Zustand des Wegs von hier bis nach Santa Fe ist. Sie versichern uns mehrmals, dass dies hier die einzige, die letzte für uns und den Unimog unpassierbare Stelle sei und dass der Weg ab hier bis nach Santa Fe viel besser werden würde. „No problema, seguro!“ Da wir natürlich an diesem Punkt nicht wirklich Lust haben umzudrehen, sagen wir zu, sie marschieren daraufhin  gleich los und kommen in kürzester Zeit mit leeren Säcken, Spitzhacken, Macheten und Schaufeln zurück. Sie arbeiten dann, zusammen mit Karl, fast zwei Stunden lang, hacken mit den Macheten die dicken, in den Weg ragenden Aststümpfe herunter, graben die Böschung ab und tatsächlich schaffen sie es dadurch und mit den gefüllten,
gleich los und kommen in kürzester Zeit mit leeren Säcken, Spitzhacken, Macheten und Schaufeln zurück. Sie arbeiten dann, zusammen mit Karl, fast zwei Stunden lang, hacken mit den Macheten die dicken, in den Weg ragenden Aststümpfe herunter, graben die Böschung ab und tatsächlich schaffen sie es dadurch und mit den gefüllten,  gestapelten Säcken mit denen sie den Raum unter der Abbruchkante zusätzlich auffüllen, den Weg um die mindestens fehlenden 30 cm zu verbreitern. Inzwischen ist das ganze Dorf hier zusammengekommen, Kinder, Erwachsene, einfach alle sind da und haben viel Spaß – Endlich mals was los hier in den Bergen! Es ist schon fast dunkel geworden als es dann endlich soweit ist, dass der Unimog die Engstelle passieren soll. Ich bin immer noch skeptisch, ob die Verbreiterung unserem sieben Tonnen schweren „Zu Hause“ wirklich standhalten wird und zittere mit, während ich totzdem
gestapelten Säcken mit denen sie den Raum unter der Abbruchkante zusätzlich auffüllen, den Weg um die mindestens fehlenden 30 cm zu verbreitern. Inzwischen ist das ganze Dorf hier zusammengekommen, Kinder, Erwachsene, einfach alle sind da und haben viel Spaß – Endlich mals was los hier in den Bergen! Es ist schon fast dunkel geworden als es dann endlich soweit ist, dass der Unimog die Engstelle passieren soll. Ich bin immer noch skeptisch, ob die Verbreiterung unserem sieben Tonnen schweren „Zu Hause“ wirklich standhalten wird und zittere mit, während ich totzdem  versuche, das Ganze auf Video festzuhalten (übrigens, wem es noch nicht aufgefallen ist, es gibt inzwischen auf der homepage bereits einige Videos unserer Reise unter „Media“ „Videos“ zu finden und es folgen immer
versuche, das Ganze auf Video festzuhalten (übrigens, wem es noch nicht aufgefallen ist, es gibt inzwischen auf der homepage bereits einige Videos unserer Reise unter „Media“ „Videos“ zu finden und es folgen immer  wieder neue). Ganz langsam und eng an der Böschung entlang nähert sich Karl der Engstelle, schiebt, als er schon fast in der Kurve ist, nocheinmal etwas zurück, um einen besseren Winkel zu haben, ich schließe kurz die Augen, sende ein Stoßgebet zum Himmel und höre gleich darauf, wie die Leute rundherum jubeln, als es geschafft ist. Der ganze Druck der letzten Stunden fällt schlagartig von mir ab und ich bin einfach nur fertig aber auch mega erleichtert, Karl und den Unimog so unversehrt zu sehen. Dann geht’s ans Bezahlen und was macht der freundliche Europäer in so einer Situation, voll von positivem Adrenalin? Klar, er gibt ein Trinkgeld! So wandern ein paar zusätzliche hundert Lempira in die Taschen der jungen Männer, die sich sehr darüber zu freuen scheinen, aber auf wundersame Weise dann auch gleich einmal verschwunden sind. Der Rest des Dorfes verlässt mit uns gemeinsam
wieder neue). Ganz langsam und eng an der Böschung entlang nähert sich Karl der Engstelle, schiebt, als er schon fast in der Kurve ist, nocheinmal etwas zurück, um einen besseren Winkel zu haben, ich schließe kurz die Augen, sende ein Stoßgebet zum Himmel und höre gleich darauf, wie die Leute rundherum jubeln, als es geschafft ist. Der ganze Druck der letzten Stunden fällt schlagartig von mir ab und ich bin einfach nur fertig aber auch mega erleichtert, Karl und den Unimog so unversehrt zu sehen. Dann geht’s ans Bezahlen und was macht der freundliche Europäer in so einer Situation, voll von positivem Adrenalin? Klar, er gibt ein Trinkgeld! So wandern ein paar zusätzliche hundert Lempira in die Taschen der jungen Männer, die sich sehr darüber zu freuen scheinen, aber auf wundersame Weise dann auch gleich einmal verschwunden sind. Der Rest des Dorfes verlässt mit uns gemeinsam  langsam den Ort des Geschehens und wir folgen ihnen zu ihren Hütten, neben denen wir über Nacht stehenbleiben dürfen. Wir parken den Unimog ein, die Dorfgemeinschaft bleibt aber weiterhin rund um uns versammelt und alle schauen neugierig durch die jetzt offene Kabinentüre. Sämtliche Kinder klettern über die Leiter herein, damit die Eltern ein Foto von ihnen und dem Unimog machen können und keiner (außer vielleicht mir) scheint hier Lust aufs Schlafengehen zu haben. Karl ist auch noch draußen und ich sehe wie ein Mann versucht ihm etwas zu sagen, was er auf spanisch jedoch nicht versteht, aber er schickt ihn damit zu mir. Er fragt mich dann, was wir denn eigentlich hier machen und ich antworte ihm, dass wir morgen weiter nach Santa Fe fahren werden. Da schüttelt er den Kopf und meint ganz ernst: „Nach Santa Fe? – Auf diesem Weg? – Mit diesem LKW? Da habt ihr überhaupt keine Chance. Die Straße nach Santa Fe wird ab hier noch viel schlechter und enger und ist allerhöchstens mit einem Motorrad zu bewältigen.“ Waaas?!“ Ich glaube ich hab mich verhört und frage noch zweimal nach, ob ich das auch richtig verstanden habe. Er bleibt dabei und schlagartig wird mir klar, dass uns die jungen Männer einfach
langsam den Ort des Geschehens und wir folgen ihnen zu ihren Hütten, neben denen wir über Nacht stehenbleiben dürfen. Wir parken den Unimog ein, die Dorfgemeinschaft bleibt aber weiterhin rund um uns versammelt und alle schauen neugierig durch die jetzt offene Kabinentüre. Sämtliche Kinder klettern über die Leiter herein, damit die Eltern ein Foto von ihnen und dem Unimog machen können und keiner (außer vielleicht mir) scheint hier Lust aufs Schlafengehen zu haben. Karl ist auch noch draußen und ich sehe wie ein Mann versucht ihm etwas zu sagen, was er auf spanisch jedoch nicht versteht, aber er schickt ihn damit zu mir. Er fragt mich dann, was wir denn eigentlich hier machen und ich antworte ihm, dass wir morgen weiter nach Santa Fe fahren werden. Da schüttelt er den Kopf und meint ganz ernst: „Nach Santa Fe? – Auf diesem Weg? – Mit diesem LKW? Da habt ihr überhaupt keine Chance. Die Straße nach Santa Fe wird ab hier noch viel schlechter und enger und ist allerhöchstens mit einem Motorrad zu bewältigen.“ Waaas?!“ Ich glaube ich hab mich verhört und frage noch zweimal nach, ob ich das auch richtig verstanden habe. Er bleibt dabei und schlagartig wird mir klar, dass uns die jungen Männer einfach  eiskalt reingelegt haben, nur um an unser Geld zu kommen. Ich übersetze Karl, was der Mann gesagt hat, der ist zwar auch nicht gerade erfreut, dass wir nun morgen doch wieder den ganzen Weg zurückfahren müssen, aber im
eiskalt reingelegt haben, nur um an unser Geld zu kommen. Ich übersetze Karl, was der Mann gesagt hat, der ist zwar auch nicht gerade erfreut, dass wir nun morgen doch wieder den ganzen Weg zurückfahren müssen, aber im Gegensatz zu mir regt ihn der Betrug nicht so extrem auf. Ich aber kann mich nicht so schnell beruhigen, ich bin diesmal echt sauer auf diese verlogenen Honduraner, die ohne mit der Wimper zu zucken unsere Notlage eiskalt zu ihrem Vorteil ausgenützt und sich dann schnell aus dem Staub gemacht haben…! Aber was soll’s, am nächsten Morgen ist auch meine Wut wieder verflogen, gleich als es hell wird, wecken uns die Dorfhähne, die freilaufende Schweinefamilie und die Dorfkinder in jeweils etwa gleicher Lautstärke, wir verteilen dann zum
Gegensatz zu mir regt ihn der Betrug nicht so extrem auf. Ich aber kann mich nicht so schnell beruhigen, ich bin diesmal echt sauer auf diese verlogenen Honduraner, die ohne mit der Wimper zu zucken unsere Notlage eiskalt zu ihrem Vorteil ausgenützt und sich dann schnell aus dem Staub gemacht haben…! Aber was soll’s, am nächsten Morgen ist auch meine Wut wieder verflogen, gleich als es hell wird, wecken uns die Dorfhähne, die freilaufende Schweinefamilie und die Dorfkinder in jeweils etwa gleicher Lautstärke, wir verteilen dann zum  Abschied die letzten Lutscher und machen uns auf die anstrengende Rückfahrt, auf der uns sämtliche Engstellen jetzt wieder, diesmal halt nur von der anderen Seite, bevorstehen. Nachdem wir dann, nach
Abschied die letzten Lutscher und machen uns auf die anstrengende Rückfahrt, auf der uns sämtliche Engstellen jetzt wieder, diesmal halt nur von der anderen Seite, bevorstehen. Nachdem wir dann, nach wiederum viel Schweiß und Nerven, gut zurück in der Zivilisation gelandet sind, sind wir beide froh, dass alles so gut ausgegangen
wiederum viel Schweiß und Nerven, gut zurück in der Zivilisation gelandet sind, sind wir beide froh, dass alles so gut ausgegangen ist und dass wir unverletzt sind und der Unimog heil geblieben ist. Nicht auszudenken, hätte unsere Reise nur wegen unserer Abenteuerlust in einem Graben im Dschungel von Honduras geendet,…! Schon bei der Hinfahrt am Vortag haben wir einen schönen, einsamen Strand entdeckt den wir jetzt ansteuern und wo wir dann gleich ins türkisblaue, lauwarme Meer springen. Später belohnen wir uns für die Anstrengungen mit gebratenem Schweinefleisch und Semmelknödeln (die ersten seit zehn Monaten!) und lassen bei ein paar Bier unseren „Ausflug“ nocheinmal revuepassieren.
ist und dass wir unverletzt sind und der Unimog heil geblieben ist. Nicht auszudenken, hätte unsere Reise nur wegen unserer Abenteuerlust in einem Graben im Dschungel von Honduras geendet,…! Schon bei der Hinfahrt am Vortag haben wir einen schönen, einsamen Strand entdeckt den wir jetzt ansteuern und wo wir dann gleich ins türkisblaue, lauwarme Meer springen. Später belohnen wir uns für die Anstrengungen mit gebratenem Schweinefleisch und Semmelknödeln (die ersten seit zehn Monaten!) und lassen bei ein paar Bier unseren „Ausflug“ nocheinmal revuepassieren.
Am nächsten Tag plane ich umgehend um! Ich will nun nicht mehr noch tiefer hinein in den „Amazonas von Mittelamerika“, ich will keine weiteren strichlierten Straßen ausprobieren und dabei vielleicht „im Nirgendwo“ im Sumpf steckenbleiben und vor allem ist mir klar geworden, wie lange man in diesem Gebiet für auf der Karte so kurz aussehende Strecken wirklich braucht. Unsere Entscheidung resultiert aber nicht nur aus den Nachwirkungen unserer Dschungeltour, wir haben einfach auch zu wenig Zeit übrig, um dieses riesige, großteils völlig unerschlossene Gebiet der „Moskitia“ einmal komplett zu durchqueren, denn dafür würde, das ist uns jetzt klar, ein weiteres Monat wahrscheinlich gerade mal so ausreichen. Ich suche also eine kleine aber befestigte Straße aus, die uns über die Berge zur fast vierhundert Kilometer entfernten Grenze nach Nicaragua bringt und bin ziemlich sicher, dass auch das reichen wird für unsere abschließenden Tage in Honduras.
Die Fahrt durch die fantastische, grüne Berglandschaft und die vielen wirklich wunderbaren Menschen die wir dabei treffen, versöhnt mich dann aber doch wieder ein bisschen mit diesem Land. Der Wachdienst eines Supermarkts lässt uns bei Einbruch der Dunkelheit ganz selbstverständlich kostenlos auf deren Parkplatz übernachten, das gleiche gilt für die Belegschaft einer kleinen Tankstelle, die uns neben der Toilettenbenützung auch noch ihr wlan und ihren Fitnessraum (?!) anbietet. Um aber auf meine erste Überschrift in diesem Beitrag zurückzukommen („Ich weiß noch nicht ob ich Honduras mag,…), muss ich sagen: Die  große Liebe ist es für mich nicht geworden. Wenn man mich fragt woran es liegt? – Ich habe viel darüber nachgedacht, aber ich weiß es nicht genau. Das Land hat ganz sicher wunderschöne Seiten, nirgends haben wir z.B. vorher so großartige Karibikstrände genossen wie hier, aber es fehlt ihm irgendwie die Lieblichkeit der anderen zentralamerikanischen Länder, wie z.B. kleine, hübsche Dörfer (mit Ausnahme von „Santa Lucia“ haben wir nicht ein einziges gesehen), bunte Märkte oder Städte mit kolonialen Bauten. Vielleicht liegt es auch daran, dass Honduras in der Vergangenheit zu viel „herumgestoßen“ wurde. Es gehörte abwechselnd zu England, zu Spanien und zu Mexico, die Menschen hier bestehen aus einem riesigen, ethnischen Mix, für den man vielleicht etwas länger als nur ein paar Wochen braucht um ihn besser zu verstehen. Es ist uns hier zum ersten Mal passiert, dass die besser gebildete Schicht uns freundlicher begrüßt hat als die armen Leute am Land, die meiner Meinung nach oft in uns nichts außer eine prall gefüllte Brieftasche gesehen haben. Ich weiß, dass die Bevölkerung hier großteils wirklich arm ist und ich bin auch gerne bereit, in diesen Ländern überall Touristenpreise zu zahlen, aber für mich rechtfertigt das nicht, dass ein Großteil dieser Leute, kaum dass man irgendwo auftaucht, ausschließlich darüber nachzudenken scheint, wie sie einem möglichst schnell möglichst viel Geld abnehmen können und dabei wirklich
große Liebe ist es für mich nicht geworden. Wenn man mich fragt woran es liegt? – Ich habe viel darüber nachgedacht, aber ich weiß es nicht genau. Das Land hat ganz sicher wunderschöne Seiten, nirgends haben wir z.B. vorher so großartige Karibikstrände genossen wie hier, aber es fehlt ihm irgendwie die Lieblichkeit der anderen zentralamerikanischen Länder, wie z.B. kleine, hübsche Dörfer (mit Ausnahme von „Santa Lucia“ haben wir nicht ein einziges gesehen), bunte Märkte oder Städte mit kolonialen Bauten. Vielleicht liegt es auch daran, dass Honduras in der Vergangenheit zu viel „herumgestoßen“ wurde. Es gehörte abwechselnd zu England, zu Spanien und zu Mexico, die Menschen hier bestehen aus einem riesigen, ethnischen Mix, für den man vielleicht etwas länger als nur ein paar Wochen braucht um ihn besser zu verstehen. Es ist uns hier zum ersten Mal passiert, dass die besser gebildete Schicht uns freundlicher begrüßt hat als die armen Leute am Land, die meiner Meinung nach oft in uns nichts außer eine prall gefüllte Brieftasche gesehen haben. Ich weiß, dass die Bevölkerung hier großteils wirklich arm ist und ich bin auch gerne bereit, in diesen Ländern überall Touristenpreise zu zahlen, aber für mich rechtfertigt das nicht, dass ein Großteil dieser Leute, kaum dass man irgendwo auftaucht, ausschließlich darüber nachzudenken scheint, wie sie einem möglichst schnell möglichst viel Geld abnehmen können und dabei wirklich  keinerlei Hemmungen zu kennen scheinen. Überall im Land sieht man außerdem junge Leute nur mit ihren Handys herumsitzen, im Gegensatz zu El Salvador oder Guatemala, wo die meisten irgendwo unterwegs waren um etwas zu verkaufen oder anderweitig Geld zu verdienen. Es steht mir sicher nicht zu, die Menschen von Honduras als faul zu bezeichnen, wie es ihre Nachbarn ohnedies tun. Aber es fällt schon auf, dass
keinerlei Hemmungen zu kennen scheinen. Überall im Land sieht man außerdem junge Leute nur mit ihren Handys herumsitzen, im Gegensatz zu El Salvador oder Guatemala, wo die meisten irgendwo unterwegs waren um etwas zu verkaufen oder anderweitig Geld zu verdienen. Es steht mir sicher nicht zu, die Menschen von Honduras als faul zu bezeichnen, wie es ihre Nachbarn ohnedies tun. Aber es fällt schon auf, dass gerade ein Großteil der jungen Generation einfach nur von einem besseren Leben am besten in „El Norte“ (im Norden, gemeint sind die USA) träumt, ohne aber eine Ahnung davon zu haben, dass auch dort alles nur mit viel harter Arbeit erreichbar ist, was natürlich auch an der erschreckend niedrigen Bildung in diesem Land liegt. Sie scheinen halt wirklich viel davon zu glauben, was ihnen speziell das Internet hierzu suggeriert. Was uns allerdings wieder einmal überhaupt nicht untergekommen ist in ganz Honduras, war Kriminalität oder Korruption in irgendeiner Form. Weder in der Stadt noch auf dem Land haben wir uns jemals unsicher oder bedroht gefühlt, insofern können wir wenigstens dieses schwere Image von Honduras als „Bösewicht Zentralamerikas“ auf keinen Fall unterschreiben.
gerade ein Großteil der jungen Generation einfach nur von einem besseren Leben am besten in „El Norte“ (im Norden, gemeint sind die USA) träumt, ohne aber eine Ahnung davon zu haben, dass auch dort alles nur mit viel harter Arbeit erreichbar ist, was natürlich auch an der erschreckend niedrigen Bildung in diesem Land liegt. Sie scheinen halt wirklich viel davon zu glauben, was ihnen speziell das Internet hierzu suggeriert. Was uns allerdings wieder einmal überhaupt nicht untergekommen ist in ganz Honduras, war Kriminalität oder Korruption in irgendeiner Form. Weder in der Stadt noch auf dem Land haben wir uns jemals unsicher oder bedroht gefühlt, insofern können wir wenigstens dieses schwere Image von Honduras als „Bösewicht Zentralamerikas“ auf keinen Fall unterschreiben.
Der Abschied fällt uns, bzw. vor allem mir (Karl hatte mit dem Land überhaupt keine Probleme) dieses Mal nicht ganz so schwer und für uns geht es nun also wieder weiter. Wir betreten morgen mittlerweile schon das achte Land auf unserer Reise und sind schon sehr gespannt darauf, unter anderem „Semana Santa“ die Osterwoche, in Nicaragua verbringen zu dürfen.