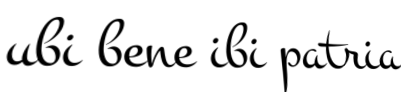Zur Jungfrau von Copacabana oder „Hilft ein Segen auch gegen leere Tanks?“
Jetzt also Bolivien! Vom fünftgrößten Land Südamerikas, das damit ca. dreimal so groß ist wie Deutschland und benannt wurde nach dem großen, südamerikanischen Freiheitskämpfer „Simon Bolivar“, habe ich im Vorfeld so gut wie überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nur, dass dort irgendwo im Süden  die „größte Salzpfanne der Welt“ liegt, der „Salar de Uyuni“, von dem Reisende immer wieder in höchsten Tönen schwärmen – Und das war’s dann auch schon. Selbst wenn man bei anderen Overlandern nachfragt, die aus dem Süden kommen, bekommt man meistens nur als Antwort, dass der „Salar“ deren einziges Ziel in Bolivien gewesen sei, man aber ansonsten eben nur durchgefahren wäre und daher nicht viel über das Land erzählen könne. Also gut, das sind nicht wirklich viele Vorinformationen, aber wir werden das schon alles herausfinden. Zu unserer Einreise fahren wir einfach entlang des Ufers des „Titicacasees“ bis zu einem winzigen Grenzübergang, denn unser erstes Ziel liegt gleich auf der bolivianischen Seite des Sees und heißt „Copacabana“. Es handelt sich hierbei um den wichtigsten und bekanntesten Wallfahrtsort von Bolivien und dieser kleine Ort ist außerdem – man glaubt es kaum – der Namensgeber für den weltbekannten Strand von „
die „größte Salzpfanne der Welt“ liegt, der „Salar de Uyuni“, von dem Reisende immer wieder in höchsten Tönen schwärmen – Und das war’s dann auch schon. Selbst wenn man bei anderen Overlandern nachfragt, die aus dem Süden kommen, bekommt man meistens nur als Antwort, dass der „Salar“ deren einziges Ziel in Bolivien gewesen sei, man aber ansonsten eben nur durchgefahren wäre und daher nicht viel über das Land erzählen könne. Also gut, das sind nicht wirklich viele Vorinformationen, aber wir werden das schon alles herausfinden. Zu unserer Einreise fahren wir einfach entlang des Ufers des „Titicacasees“ bis zu einem winzigen Grenzübergang, denn unser erstes Ziel liegt gleich auf der bolivianischen Seite des Sees und heißt „Copacabana“. Es handelt sich hierbei um den wichtigsten und bekanntesten Wallfahrtsort von Bolivien und dieser kleine Ort ist außerdem – man glaubt es kaum – der Namensgeber für den weltbekannten Strand von „ Rio de Janeiro“. Wenn ich hier schon so oft geschrieben habe, dass die Grenzformalitäten einfach und unspektakulär waren, toppt dieser hier alles. Fünf Minuten brauchen wir für die Ausreise aus Peru und so schnell wie der Beamte beim bolivianischen Zoll anschließend unsere Daten für den Unimog in seinen Computer klopft und die Stempel auf das Dokument draufhaut, das haben wir noch nirgends erlebt, eventuell will er aber auch nur so schnell wie möglich zurück zu seinem Sandwich, das angebissen neben seinem Computer liegt. Jedenfalls reisen wir innerhalb von nicht einmal 20 Minuten von Peru aus und in Bolivien ein, das ist
Rio de Janeiro“. Wenn ich hier schon so oft geschrieben habe, dass die Grenzformalitäten einfach und unspektakulär waren, toppt dieser hier alles. Fünf Minuten brauchen wir für die Ausreise aus Peru und so schnell wie der Beamte beim bolivianischen Zoll anschließend unsere Daten für den Unimog in seinen Computer klopft und die Stempel auf das Dokument draufhaut, das haben wir noch nirgends erlebt, eventuell will er aber auch nur so schnell wie möglich zurück zu seinem Sandwich, das angebissen neben seinem Computer liegt. Jedenfalls reisen wir innerhalb von nicht einmal 20 Minuten von Peru aus und in Bolivien ein, das ist  neuer Rekord! Karl stellt noch seine Uhr um eine Stunde vor (ich lebe jetzt seit fast zwei Jahren genussvoll ohne Uhr, weiß auch meistens nicht einmal welcher Wochentag gerade ist…), da der Unterschied zu Mitteleuropa ab hier nur mehr fünf Stunden beträgt und kurz darauf erreichen wir bei strahlendem Sonnenschein auch schon „Copacabana“. Wir finden schnell einen Gratis-Standplatz am See, direkt neben dem Ortszentrum und sind froh, dass wir gleich am Anfang unseres Bolivien-Aufenthalts in einem so symphatischen Städtchen gelandet sind. Wir wollen ein paar Tage hierbleiben, Karl laboriert schon seit La Paz an einer Grippe und legt sich gleich ins Bett, ich will meinen Peru-Reisebericht fertigstellen,
neuer Rekord! Karl stellt noch seine Uhr um eine Stunde vor (ich lebe jetzt seit fast zwei Jahren genussvoll ohne Uhr, weiß auch meistens nicht einmal welcher Wochentag gerade ist…), da der Unterschied zu Mitteleuropa ab hier nur mehr fünf Stunden beträgt und kurz darauf erreichen wir bei strahlendem Sonnenschein auch schon „Copacabana“. Wir finden schnell einen Gratis-Standplatz am See, direkt neben dem Ortszentrum und sind froh, dass wir gleich am Anfang unseres Bolivien-Aufenthalts in einem so symphatischen Städtchen gelandet sind. Wir wollen ein paar Tage hierbleiben, Karl laboriert schon seit La Paz an einer Grippe und legt sich gleich ins Bett, ich will meinen Peru-Reisebericht fertigstellen, hole mir die ersten „Bolivianos“ vom Geldautomaten und suche mir dann ein gemütliches Lokal mit wlan. Das schlechte Internet von Peru setzt sich hier in Bolivien leider fort und das Hochladen der wirklich vielen Fotos die sich während unserer fantastischen Zeit in Peru angesammelt haben, gestaltet sich dadurch zu einer echten Nervenprobe. Hilfreich ist dabei allerding das wunderbare, bolivianische
hole mir die ersten „Bolivianos“ vom Geldautomaten und suche mir dann ein gemütliches Lokal mit wlan. Das schlechte Internet von Peru setzt sich hier in Bolivien leider fort und das Hochladen der wirklich vielen Fotos die sich während unserer fantastischen Zeit in Peru angesammelt haben, gestaltet sich dadurch zu einer echten Nervenprobe. Hilfreich ist dabei allerding das wunderbare, bolivianische  „Huari“-Bier, das ich hier zum ersten Mal probiere. Am dritten Tag, Karl ist noch immer nicht wirklich fit, will aber trotzdem weiterfahren, begeben wir uns samt Unimog ins Ortszentrum zu der schönen Wallfahrtskirche,
„Huari“-Bier, das ich hier zum ersten Mal probiere. Am dritten Tag, Karl ist noch immer nicht wirklich fit, will aber trotzdem weiterfahren, begeben wir uns samt Unimog ins Ortszentrum zu der schönen Wallfahrtskirche, die vor allem dafür bekannt ist, dass hier täglich Autosegnungen durchgeführt werden. Nahezu jeder Bolivianer und auch ganz viele Peruaner, also einfach alle, die es sich irgendwie leisten können, kommen, nachdem sie sich ein neues oder auch gebrauchtes Auto zugelegt haben, damit nach „Copacabana“ um es hier segnen zu lassen, was mich bei dem Verkehr in den beiden
die vor allem dafür bekannt ist, dass hier täglich Autosegnungen durchgeführt werden. Nahezu jeder Bolivianer und auch ganz viele Peruaner, also einfach alle, die es sich irgendwie leisten können, kommen, nachdem sie sich ein neues oder auch gebrauchtes Auto zugelegt haben, damit nach „Copacabana“ um es hier segnen zu lassen, was mich bei dem Verkehr in den beiden  Ländern nicht im Geringsten wundert! Schaden kann das auf keinen Fall denken wir uns, bei den Abenteuern die wir auf unserer Reise jeden Tag erleben, sollte man keine Gelegenheit auslassen, um für Schutz zu sorgen, also los. Zu
Ländern nicht im Geringsten wundert! Schaden kann das auf keinen Fall denken wir uns, bei den Abenteuern die wir auf unserer Reise jeden Tag erleben, sollte man keine Gelegenheit auslassen, um für Schutz zu sorgen, also los. Zu  diesem Anlass ist es üblich, dass das Fahrzeug mit Blumen geschmückt wird und daher haben sich auf dem Vorplatz der Wallfahrtskirche schon jede Menge geschäftstüchtige Blumenhändlerinnen versammelt, die hierzu ihre Dienste anbieten. Die Kosten für die Dekoration halten sich wirklich in Grenzen und unser Unimog bekommt natürlich gleich einmal die Luxusvariante,
diesem Anlass ist es üblich, dass das Fahrzeug mit Blumen geschmückt wird und daher haben sich auf dem Vorplatz der Wallfahrtskirche schon jede Menge geschäftstüchtige Blumenhändlerinnen versammelt, die hierzu ihre Dienste anbieten. Die Kosten für die Dekoration halten sich wirklich in Grenzen und unser Unimog bekommt natürlich gleich einmal die Luxusvariante, wobei sich die freundliche junge Dekorateurin dann „all inclusive“ auch noch als Fotografin der Zeremonie zur Verfügung stellt. Nur den Sekt, den man zusätzlich noch während der Segnung auf das Auto versprühen könnte, den sparen wir uns dann doch, wer mich kennt weiß, wäre die Flasche kalt gewesen, hätte
wobei sich die freundliche junge Dekorateurin dann „all inclusive“ auch noch als Fotografin der Zeremonie zur Verfügung stellt. Nur den Sekt, den man zusätzlich noch während der Segnung auf das Auto versprühen könnte, den sparen wir uns dann doch, wer mich kennt weiß, wäre die Flasche kalt gewesen, hätte ich ihn sehr wahrscheinlich zum feierlichen Anlass getrunken, aber lauwarm machen sie halt damit leider dann doch kein Geschäft mit mir… . Ein junger Monsignore nimmt dann die Segnung vor, kassiert dafür natürlich auch noch eine „freiwillige“ Spende, ja klar, was ist schon gratis heutzutage. Die angemessene Höhe der Spende wird
ich ihn sehr wahrscheinlich zum feierlichen Anlass getrunken, aber lauwarm machen sie halt damit leider dann doch kein Geschäft mit mir… . Ein junger Monsignore nimmt dann die Segnung vor, kassiert dafür natürlich auch noch eine „freiwillige“ Spende, ja klar, was ist schon gratis heutzutage. Die angemessene Höhe der Spende wird  einem vorher schon diskret von der Blumenhändlerin zugeflüstert, was soll man sagen, die katholische Kirche überlässt auch hier lieber nichts dem Zufall, oder wahrscheinlich haben die Padres halt auch schon schlechte Erfahrungen mit den ewig knapp bei Kasse befindlichen Overlandern gemacht. Aber nicht nur den Segen der „Jungfrau von Copacabana“ gibt es hier, eine in der typischen, indigenen Landestracht gekleidete, bolivianische Frau versorgt den Unimog samt uns anschließend noch mit dem Segen der „Pachamama“, womit in großen Teilen Südamerikas die „Mutter Erde“ und somit die Natur und der Boden gemeint sind. Hier wird uns die dafür erwartete Spende im Anschluss von der Dame selbstbewusst direkt mitgeteilt und so, versorgt mit dem doppelten Segen, aber nur mehr knapp an weltlichen Bolivianos, machen wir uns auf den Weg zum nächsten Geldautomaten, um anschließend unsere Reise fortsetzen zu können.
einem vorher schon diskret von der Blumenhändlerin zugeflüstert, was soll man sagen, die katholische Kirche überlässt auch hier lieber nichts dem Zufall, oder wahrscheinlich haben die Padres halt auch schon schlechte Erfahrungen mit den ewig knapp bei Kasse befindlichen Overlandern gemacht. Aber nicht nur den Segen der „Jungfrau von Copacabana“ gibt es hier, eine in der typischen, indigenen Landestracht gekleidete, bolivianische Frau versorgt den Unimog samt uns anschließend noch mit dem Segen der „Pachamama“, womit in großen Teilen Südamerikas die „Mutter Erde“ und somit die Natur und der Boden gemeint sind. Hier wird uns die dafür erwartete Spende im Anschluss von der Dame selbstbewusst direkt mitgeteilt und so, versorgt mit dem doppelten Segen, aber nur mehr knapp an weltlichen Bolivianos, machen wir uns auf den Weg zum nächsten Geldautomaten, um anschließend unsere Reise fortsetzen zu können.
Es geht heute weiter in Richtung „La Paz“, das als riesiger Verkehrsmoloch berüchtigt ist und das wir daher eigentlich, zugunsten der angeblich sehr schönen Hauptstadt „Sucre“, umfahren wollten. Da wir aber schon wieder einmal Öl verlieren (verflixt, es ist doch wirklich langsam nicht mehr zu glauben…) und ich herausgefunden habe, dass es in „La Paz“ eine bei Overlandern bekannte Werkstatt eines Schweizers gibt, führt eben jetzt doch kein Weg an „La Paz“ vorbei. Abgesehen von diesem kleinen Ölproblem befinden wir uns aber eigentlich gerade in einer Art „Wohlfühlblase“, bedingt durch die so wunderbare und problemlose Zeit in Peru, an die wir jetzt natürlich glauben nahtlos anschließen zu können. Aber weit gefehlt! Bevor wir von Peru nach Bolivien gewechselt sind, haben wir uns, so wie immer, über die Dieselpreise des nächsten Landes schlau gemacht und herausgefunden, dass Diesel in Bolivien für die Einheimischen subventioniert wird und diese so ca. umgerechnet € 0,50 pro l bezahlen. Für Ausländer werden ca. € 0,70 bis 0,90 berechnet, je nach Tankstelle und Verhandlungsgeschick, bei kleineren Tankstellen außerhalb der Städte, die über keine Kameraüberwachung verfügen, könne man  öfter mit etwas Glück sogar den Einheimischenpreis abstauben. Genau das sind unsere Informationen als wir in „Copacabana“ aufbrechen und genau deswegen hat der sparsame Overlander noch im teureren Peru seine gesamten Dieseltanks fast, und alle Reservekanister, die noch mit billigem ecuadorianischen Diesel gefüllt waren, komplett geleert. Dass wir dann in dem kleinen Städtchen „Copacabana“ bei den dortigen zwei Tankstellen keinen Diesel bekommen, weil sie angeblich keinen haben, regt uns nicht weiter auf, wir fahren ja sowieso Richtung „La Paz“ und bis dahin oder eben dort wird das Ganze ja wohl kein Problem sein… . Eine leichte Erkenntnis, dass wir uns hierbei wohl verschätzt haben, tut sich in uns bereits auf dem Weg nach „La Paz“ auf, als man uns in keiner einzigen der am Weg liegenden Tankstellen Diesel verkaufen will. Erst heißt es immer sie hätten keinen, dann sehen wir lange Schlangen von 50 und mehr LKWs vor bestimmten Tankstellen, also muss es dort wohl Diesel geben, aber auf unsere Nachfrage hin heißt es dazu immer: Ja, wir haben Diesel, aber nicht für Ausländer… – „Wie bitte“!?! Ich überprüfe im Internet nocheinmal alle Informationen die ich zu Bolivien finden kann, vielleicht habe ich ja irgendwas im Bezug auf Treibstoff übersehen, aber nein, es ist nichts dazu zu lesen.
öfter mit etwas Glück sogar den Einheimischenpreis abstauben. Genau das sind unsere Informationen als wir in „Copacabana“ aufbrechen und genau deswegen hat der sparsame Overlander noch im teureren Peru seine gesamten Dieseltanks fast, und alle Reservekanister, die noch mit billigem ecuadorianischen Diesel gefüllt waren, komplett geleert. Dass wir dann in dem kleinen Städtchen „Copacabana“ bei den dortigen zwei Tankstellen keinen Diesel bekommen, weil sie angeblich keinen haben, regt uns nicht weiter auf, wir fahren ja sowieso Richtung „La Paz“ und bis dahin oder eben dort wird das Ganze ja wohl kein Problem sein… . Eine leichte Erkenntnis, dass wir uns hierbei wohl verschätzt haben, tut sich in uns bereits auf dem Weg nach „La Paz“ auf, als man uns in keiner einzigen der am Weg liegenden Tankstellen Diesel verkaufen will. Erst heißt es immer sie hätten keinen, dann sehen wir lange Schlangen von 50 und mehr LKWs vor bestimmten Tankstellen, also muss es dort wohl Diesel geben, aber auf unsere Nachfrage hin heißt es dazu immer: Ja, wir haben Diesel, aber nicht für Ausländer… – „Wie bitte“!?! Ich überprüfe im Internet nocheinmal alle Informationen die ich zu Bolivien finden kann, vielleicht habe ich ja irgendwas im Bezug auf Treibstoff übersehen, aber nein, es ist nichts dazu zu lesen.
Immer noch sind wir aber optimistisch, dass sich die Situation in der Millionenstadt „La Paz“ sicher ändern werde, da es dort ja Tankstellen in Hülle und  Fülle geben müsse. Auf dem Weg dorthin müssen wir noch einmal einen Ausläufer des „Titicacasees“ überqueren, die
Fülle geben müsse. Auf dem Weg dorthin müssen wir noch einmal einen Ausläufer des „Titicacasees“ überqueren, die  hiesigen Einheimischen wehren sich hier seit Jahrzehnten erfolgreich gegen den Bau einer Brücke, unzählige, flache Fährboote stehen bereit, um sämtliche Fahrzeuge in ca. fünfzehn Minuten auf die andere Seeseite zu bringen. Als wir noch überlegen, wo wir wohl die Fahrkarten dazu kaufen können, werden wir bereits auf eines der Boote gewunken und kaum stehen wir drauf, fährt es auch schon ab. Wir haben ein Boot für uns alleine, viel mehr Platz wäre darauf ohnehin nicht mehr gewesen, das Ganze ist eine wirklich wackelige Angelegenheit und angeblich ist bei schlechtem Wetter und Wind auch schon das eine oder andere Fahrzeug über Bord gegangen, was wir uns sehr gut vorstellen können. Wir schaffen die Überfahrt bei Sonnenschein und ruhigem Wasser ohne Probleme, werden dafür aber bei der Ankunft richtig zur Kasse gebeten – Ja, das haben sie wirklich sehr schlau gemacht die Fährmänner, zwei Touristen schnell aufs Boot gewunken und wenn die dann mal drauf und unterwegs sind, hat sich jede Preisverhandlung ohnedies erledigt. Selber schuld, da gibt es im Nachhinein nix zu jammern.
hiesigen Einheimischen wehren sich hier seit Jahrzehnten erfolgreich gegen den Bau einer Brücke, unzählige, flache Fährboote stehen bereit, um sämtliche Fahrzeuge in ca. fünfzehn Minuten auf die andere Seeseite zu bringen. Als wir noch überlegen, wo wir wohl die Fahrkarten dazu kaufen können, werden wir bereits auf eines der Boote gewunken und kaum stehen wir drauf, fährt es auch schon ab. Wir haben ein Boot für uns alleine, viel mehr Platz wäre darauf ohnehin nicht mehr gewesen, das Ganze ist eine wirklich wackelige Angelegenheit und angeblich ist bei schlechtem Wetter und Wind auch schon das eine oder andere Fahrzeug über Bord gegangen, was wir uns sehr gut vorstellen können. Wir schaffen die Überfahrt bei Sonnenschein und ruhigem Wasser ohne Probleme, werden dafür aber bei der Ankunft richtig zur Kasse gebeten – Ja, das haben sie wirklich sehr schlau gemacht die Fährmänner, zwei Touristen schnell aufs Boot gewunken und wenn die dann mal drauf und unterwegs sind, hat sich jede Preisverhandlung ohnedies erledigt. Selber schuld, da gibt es im Nachhinein nix zu jammern.
Wir erreichen gegen Abend „La Paz“, das mit seinen in der Stadt samt Einzugsgebiet lebenden ca. 2,5 Millionen Einwohnern zwar nicht die Hauptstadt Boliviens stellt, aber dafür den Regierungssitz. Schon die außergewöhnliche Lage dieser Großstadt, die mit ihrer Lage auf 3.640 m eine der  höchstgelegenen der Welt ist und die sich vom Boden eines fast 1.000 m tiefen Talkessels bis ganz nach oben zieht, ist spektakulär. Hier ist es nicht so wie in Europa üblich, dass die Reichen oben und die Armen unten wohnen, sondern jeder in „La Paz“ der es sich leisten kann, erbaut sein Haus oder seine Villa unten auf der Talsohle. Der obere Stadtteil genannt „El Alto“ bildete sich erst nach und nach, da sich hier früher drei große Handelswege kreuzten: Silber kam aus den Minen von Potosí und wurde über „La Paz“ zum Hafen nach „Lima“ in Peru gebracht, Salz kam aus dem „Salar de Uyuni“ und nicht zu vergessen waren natürlich die Kokatransporte aus den „Yungas“, dem Dschungel des Tieflandes. Obwohl wir in punkto Verkehr aus den verschiedensten Großstädten unserer Reise bereits einiges gewöhnt sind, scheint es immer noch eine Stufe höher zu gehen, denn so etwas wie hier in „La Paz“ haben wir wirklich noch nirgends erlebt. Die unzähligen Minibusse, die hier hauptsächlich für den Personentransport verantwortlich zu sein scheinen, halten ohne zu blinken mitten auf der Fahrbahn, teilweise gleich dreispurig nebeneinander. Es gibt für sie keine fixen Haltestellen, alle paar hundert Meter steigen Fahrgäste ein oder aus. Dadurch bilden sich endlose Staus, die von den Einheimischen stoisch hingenommen werden. Regeln scheint es einfach keine zu geben, selbst über rote Ampeln wird so selbstverständlich gefahren, als wären diese überhaupt nicht vorhanden. Die dadurch nicht endenden Autoschlangen blockieren dann natürlich den Gegenverkehr, der mit
höchstgelegenen der Welt ist und die sich vom Boden eines fast 1.000 m tiefen Talkessels bis ganz nach oben zieht, ist spektakulär. Hier ist es nicht so wie in Europa üblich, dass die Reichen oben und die Armen unten wohnen, sondern jeder in „La Paz“ der es sich leisten kann, erbaut sein Haus oder seine Villa unten auf der Talsohle. Der obere Stadtteil genannt „El Alto“ bildete sich erst nach und nach, da sich hier früher drei große Handelswege kreuzten: Silber kam aus den Minen von Potosí und wurde über „La Paz“ zum Hafen nach „Lima“ in Peru gebracht, Salz kam aus dem „Salar de Uyuni“ und nicht zu vergessen waren natürlich die Kokatransporte aus den „Yungas“, dem Dschungel des Tieflandes. Obwohl wir in punkto Verkehr aus den verschiedensten Großstädten unserer Reise bereits einiges gewöhnt sind, scheint es immer noch eine Stufe höher zu gehen, denn so etwas wie hier in „La Paz“ haben wir wirklich noch nirgends erlebt. Die unzähligen Minibusse, die hier hauptsächlich für den Personentransport verantwortlich zu sein scheinen, halten ohne zu blinken mitten auf der Fahrbahn, teilweise gleich dreispurig nebeneinander. Es gibt für sie keine fixen Haltestellen, alle paar hundert Meter steigen Fahrgäste ein oder aus. Dadurch bilden sich endlose Staus, die von den Einheimischen stoisch hingenommen werden. Regeln scheint es einfach keine zu geben, selbst über rote Ampeln wird so selbstverständlich gefahren, als wären diese überhaupt nicht vorhanden. Die dadurch nicht endenden Autoschlangen blockieren dann natürlich den Gegenverkehr, der mit wütendem Hupen darauf reagiert, was aber niemanden interessiert. Zusätzlich muss man, um vom oberen in den unteren Stadtteil zu gelangen, so steile Straßenstücke überwinden, wie wir sie noch nirgends in irgendeiner Stadt gesehen haben. Wenn jemand behauptet in San Francisco seien die Straßen steil, dann war er ganz sicher noch niemals in „La Paz“! Wir tasten uns im Schrittempo nach unten und überlegen dabei, ob wir uns nicht doch eine in Bolivien freiwillige Autoversicherung kaufen sollen, denn dass wir in diesem Land unfallfrei durchkommen, wagen wir ab sofort zu bezweifeln. Erst einmal aber brauchen wir ohnedies einen Standplatz zum Übernachten und was in eigentlich allen Städten unserer Reise bisher so gut wie kein Problem war, wird in „La Paz“ plötzlich zu einem. Entweder sind die Straßen zu steil um dort irgendwo halbwegs waagrecht im Unimog schlafen zu können oder zu eng um überhaupt dort zu parken, es gibt meistens nicht einmal einen Parkstreifen und wenn, ist dieser nur ganz kurz und voll besetzt oder es ist nur kurzes Halten erlaubt. Wir irren durch die Stadt und können es nicht glauben, dass wir rein gar nichts finden, bis wir dann am Schluss doch noch neben dem
wütendem Hupen darauf reagiert, was aber niemanden interessiert. Zusätzlich muss man, um vom oberen in den unteren Stadtteil zu gelangen, so steile Straßenstücke überwinden, wie wir sie noch nirgends in irgendeiner Stadt gesehen haben. Wenn jemand behauptet in San Francisco seien die Straßen steil, dann war er ganz sicher noch niemals in „La Paz“! Wir tasten uns im Schrittempo nach unten und überlegen dabei, ob wir uns nicht doch eine in Bolivien freiwillige Autoversicherung kaufen sollen, denn dass wir in diesem Land unfallfrei durchkommen, wagen wir ab sofort zu bezweifeln. Erst einmal aber brauchen wir ohnedies einen Standplatz zum Übernachten und was in eigentlich allen Städten unserer Reise bisher so gut wie kein Problem war, wird in „La Paz“ plötzlich zu einem. Entweder sind die Straßen zu steil um dort irgendwo halbwegs waagrecht im Unimog schlafen zu können oder zu eng um überhaupt dort zu parken, es gibt meistens nicht einmal einen Parkstreifen und wenn, ist dieser nur ganz kurz und voll besetzt oder es ist nur kurzes Halten erlaubt. Wir irren durch die Stadt und können es nicht glauben, dass wir rein gar nichts finden, bis wir dann am Schluss doch noch neben dem  wunderschönen, alten Tor der ziemlich versteckten „Plaza del Monticulo“ Glück haben und einen wirklich guten und sogar ruhigen Platz ergattern, von dem aus man auch ein nahegelegenes Einkaufszentrum und diverse Lokale zu Fuß erreichen kann
wunderschönen, alten Tor der ziemlich versteckten „Plaza del Monticulo“ Glück haben und einen wirklich guten und sogar ruhigen Platz ergattern, von dem aus man auch ein nahegelegenes Einkaufszentrum und diverse Lokale zu Fuß erreichen kann und von wo aus wir einen wunderbaren Blick über die Stadt und auf die 2014 von der Firma Doppelmaye erbaute Seilbahn haben, die seither den oberen und den unteren Stadtteil verbindet. Unser nächster Weg führt uns dann am darauffolgenden Vormittag in die Werkstatt des Schweizers Ernst Hug, der schon seit 1977 in Bolivien lebt und der uns auch ohne Termin sehr freundlich empfängt. Gott sei Dank stellt sich heraus, dass nicht schon wieder irgendeine gut versteckte Dichtung das Problem für unseren Ölverlust ist, sondern dass einfach einige Schrauben beim letzten Werkstattbesuch wohl nicht fest genug angezogen worden sind, was Ernst’s Mechaniker gleich erledigen. Das ist die gute Nachricht, die schlechte
und von wo aus wir einen wunderbaren Blick über die Stadt und auf die 2014 von der Firma Doppelmaye erbaute Seilbahn haben, die seither den oberen und den unteren Stadtteil verbindet. Unser nächster Weg führt uns dann am darauffolgenden Vormittag in die Werkstatt des Schweizers Ernst Hug, der schon seit 1977 in Bolivien lebt und der uns auch ohne Termin sehr freundlich empfängt. Gott sei Dank stellt sich heraus, dass nicht schon wieder irgendeine gut versteckte Dichtung das Problem für unseren Ölverlust ist, sondern dass einfach einige Schrauben beim letzten Werkstattbesuch wohl nicht fest genug angezogen worden sind, was Ernst’s Mechaniker gleich erledigen. Das ist die gute Nachricht, die schlechte  erfahren wir ebenfalls von Ernst, nämlich, dass Bolivien seit ca. drei Wochen ein riesiges Dieselproblem hat, weil plötzlich – und keiner weiß warum – viel zu wenig Nachschub ins Land kommt. Daraus resultiert das was wir bereits erlebt haben, nämlich dass alle Tankstellen wohl angehalten sind, den dringend benötigten Diesel nicht an Ausländer zu verkaufen. Er meint, hier in „La Paz“ hätten wir wohl nahezu gar keine Chance an Diesel zu kommen, da alle großen Tankstellen mit Kameras ausgestattet wären, leichter wäre es wohl bei kleineren Tankstellen auf dem Land. Ob das aber klappen werde, könne er uns auch nicht sagen und dass die Situation weiter im Süden des Landes besser würde glaube er nicht. Im Gegenteil, er vermute sogar, dass sich die Lage in den nächsten Wochen eher verschlechtern als verbessern würde. Als Fazit meint er dann, er würde an unserer Stelle nach Peru zurückfahren um dort Tanks und Kanister zu füllen und dann damit entweder auf kürzestem Weg Bolivien zu durchqueren oder Bolivien überhaupt auszulassen und direkt von Peru nach Chile zu fahren. Auf meinen Einwand hin, dass man uns Touristen ja nicht einfach so im Regen stehen lassen könne, lacht er nur und sagt, das wäre den Bolivianern total egal, ebenso wie eine eventuelle, schlechte Publicity von den paar Touristen, die, so wie wir, mit Dieselfahrzeugen ins Land kämen. Er lässt sich noch einige Minuten über das jahrzehntelange Totalversagen der, seiner Meinung nach, völlig unfähigen, linksliberalen Regierung aus, was wir jetzt nicht zum ersten Mal hier in Südamerika hören und er bietet uns am Schluss noch an, wieder zu ihm zurückzukommen, sollten wir wirklich nicht einmal so viel Diesel auftreiben um nach Peru zurückzufahren. Er würde uns in diesem Fall dann gerne helfen, wenigstens die dafür benötigte Menge mittels Kanistern irgendwie zu besorgen. Wir bedanken uns bei ihm für das Angebot und die rasche Hilfe und verabschieden uns um zu beratschlagen. Was wir hier von Ernst erfahren haben, ist natürlich genau das, was wir auf keinen Fall hören wollten. Alle unsere Pläne, langsam und über kleine Straßen zuerst quer durchs Land und erst dann nach Süden zu fahren, lösen sich damit von einer Minute zur anderen in Rauch auf. Ich denke schon über den kürzesten Bericht der ganzen Reise „Bolivien in 20 Sätzen“ nach, dann beschließen wir, am nächsten Tag nocheinmal die Tankstellen der Stadt abzuklappern und uns außerdem eine Fahrzeugversicherung zu besorgen. Am nächsten Vormittag geht’s dann los: An den ersten Tankstellen immer wieder das gleiche Spiel: Kein Diesel für uns. Zweimal haben wir dabei jedoch das Glück, dass durch unsere Diskussionen mit den Tankwarten LKW-Fahrer, die gerade ebenfalls tanken, auf unsere Situation aufmerksam werden und uns zu verstehen geben, sie
erfahren wir ebenfalls von Ernst, nämlich, dass Bolivien seit ca. drei Wochen ein riesiges Dieselproblem hat, weil plötzlich – und keiner weiß warum – viel zu wenig Nachschub ins Land kommt. Daraus resultiert das was wir bereits erlebt haben, nämlich dass alle Tankstellen wohl angehalten sind, den dringend benötigten Diesel nicht an Ausländer zu verkaufen. Er meint, hier in „La Paz“ hätten wir wohl nahezu gar keine Chance an Diesel zu kommen, da alle großen Tankstellen mit Kameras ausgestattet wären, leichter wäre es wohl bei kleineren Tankstellen auf dem Land. Ob das aber klappen werde, könne er uns auch nicht sagen und dass die Situation weiter im Süden des Landes besser würde glaube er nicht. Im Gegenteil, er vermute sogar, dass sich die Lage in den nächsten Wochen eher verschlechtern als verbessern würde. Als Fazit meint er dann, er würde an unserer Stelle nach Peru zurückfahren um dort Tanks und Kanister zu füllen und dann damit entweder auf kürzestem Weg Bolivien zu durchqueren oder Bolivien überhaupt auszulassen und direkt von Peru nach Chile zu fahren. Auf meinen Einwand hin, dass man uns Touristen ja nicht einfach so im Regen stehen lassen könne, lacht er nur und sagt, das wäre den Bolivianern total egal, ebenso wie eine eventuelle, schlechte Publicity von den paar Touristen, die, so wie wir, mit Dieselfahrzeugen ins Land kämen. Er lässt sich noch einige Minuten über das jahrzehntelange Totalversagen der, seiner Meinung nach, völlig unfähigen, linksliberalen Regierung aus, was wir jetzt nicht zum ersten Mal hier in Südamerika hören und er bietet uns am Schluss noch an, wieder zu ihm zurückzukommen, sollten wir wirklich nicht einmal so viel Diesel auftreiben um nach Peru zurückzufahren. Er würde uns in diesem Fall dann gerne helfen, wenigstens die dafür benötigte Menge mittels Kanistern irgendwie zu besorgen. Wir bedanken uns bei ihm für das Angebot und die rasche Hilfe und verabschieden uns um zu beratschlagen. Was wir hier von Ernst erfahren haben, ist natürlich genau das, was wir auf keinen Fall hören wollten. Alle unsere Pläne, langsam und über kleine Straßen zuerst quer durchs Land und erst dann nach Süden zu fahren, lösen sich damit von einer Minute zur anderen in Rauch auf. Ich denke schon über den kürzesten Bericht der ganzen Reise „Bolivien in 20 Sätzen“ nach, dann beschließen wir, am nächsten Tag nocheinmal die Tankstellen der Stadt abzuklappern und uns außerdem eine Fahrzeugversicherung zu besorgen. Am nächsten Vormittag geht’s dann los: An den ersten Tankstellen immer wieder das gleiche Spiel: Kein Diesel für uns. Zweimal haben wir dabei jedoch das Glück, dass durch unsere Diskussionen mit den Tankwarten LKW-Fahrer, die gerade ebenfalls tanken, auf unsere Situation aufmerksam werden und uns zu verstehen geben, sie  würden uns, nachdem sie fertig getankt hätten, einen Kanister Diesel aus ihrem Tank abzapfen lassen. Natürlich muss das Ganze heimlich und in versteckten Nebenstraßen ablaufen, denn Diesel unter der Hand weiterzuverkaufen ist in Bolivien streng verboten. So ganz uneigennützig ist der Deal aber natürlich dann auch wieder nicht, denn die Fahrer verlangen, ohne mit der Wimper zu zucken, das doppelte des subventionierten Preises den sie selbst bezahlt haben und für sie ist das dadurch natürlich ein gutes Geschäft. Wir befinden uns aber derzeit sowieso nicht in der Position hier über Preise feilschen zu können, denn wir fahren im Moment wirklich nur mehr mit den allerletzten Litern. Karl verteilt also die hart erkämpften 60 l in die beiden Tanks und die Suche geht weiter. Wir konzentrieren uns jetzt nur mehr auf jene Tankstellen vor denen lange Schlangen von LKWs warten. „Kein Diesel da“ als Antwort spielt’s dort somit schon mal nicht, aber bevor wir uns hinter 50 und mehr LKWs anstellen, müssen wir natürlich klären, ob wir dann auch letztendlich wirklich Diesel bekommen. Wir fahren also unter den skeptischen Blicken der seit Stunden wartenden LKW-Fahrer direkt zur Zapfsäule vor und ich frage den Tankwart, ob wir hier als Ausländer Diesel bekommen könnten. Er meint das wäre kein Problem, wir müssten uns aber hinten anstellen. Überrascht über die positive Antwort frage ich vorsichtshalber noch ein zweites Mal nach und erst nachdem ich sicher bin, dass er mich wirklich richtig verstanden hat, fahren wir zum Ende der Kolonne, die sich weit zurück entlang der Hauptstraße und dann noch bis tief hinein in eine Seitenstraße zieht. Nach guten zwei Stunden sind wir dann fast bis zur Zapfsäule vorgerückt, als ich bemerke, dass der gleiche Tankwart mit dem ich vorher gesprochen habe, anfängt, mit fragendem Blick rund um den
würden uns, nachdem sie fertig getankt hätten, einen Kanister Diesel aus ihrem Tank abzapfen lassen. Natürlich muss das Ganze heimlich und in versteckten Nebenstraßen ablaufen, denn Diesel unter der Hand weiterzuverkaufen ist in Bolivien streng verboten. So ganz uneigennützig ist der Deal aber natürlich dann auch wieder nicht, denn die Fahrer verlangen, ohne mit der Wimper zu zucken, das doppelte des subventionierten Preises den sie selbst bezahlt haben und für sie ist das dadurch natürlich ein gutes Geschäft. Wir befinden uns aber derzeit sowieso nicht in der Position hier über Preise feilschen zu können, denn wir fahren im Moment wirklich nur mehr mit den allerletzten Litern. Karl verteilt also die hart erkämpften 60 l in die beiden Tanks und die Suche geht weiter. Wir konzentrieren uns jetzt nur mehr auf jene Tankstellen vor denen lange Schlangen von LKWs warten. „Kein Diesel da“ als Antwort spielt’s dort somit schon mal nicht, aber bevor wir uns hinter 50 und mehr LKWs anstellen, müssen wir natürlich klären, ob wir dann auch letztendlich wirklich Diesel bekommen. Wir fahren also unter den skeptischen Blicken der seit Stunden wartenden LKW-Fahrer direkt zur Zapfsäule vor und ich frage den Tankwart, ob wir hier als Ausländer Diesel bekommen könnten. Er meint das wäre kein Problem, wir müssten uns aber hinten anstellen. Überrascht über die positive Antwort frage ich vorsichtshalber noch ein zweites Mal nach und erst nachdem ich sicher bin, dass er mich wirklich richtig verstanden hat, fahren wir zum Ende der Kolonne, die sich weit zurück entlang der Hauptstraße und dann noch bis tief hinein in eine Seitenstraße zieht. Nach guten zwei Stunden sind wir dann fast bis zur Zapfsäule vorgerückt, als ich bemerke, dass der gleiche Tankwart mit dem ich vorher gesprochen habe, anfängt, mit fragendem Blick rund um den  Unimog zu schleichen, um dann im Anschluss zu mir ans Fenster zu kommen und mir zu erklären, er habe erst jetzt gesehen, dass wir ja ausländische Kennzeichen hätten und es tue ihm leid, aber er dürfe uns daher nichts verkaufen. Jetzt platzt uns aber beiden der Kragen. Ich frage den Tankwart was so schwer daran zu verstehen war, als ich vorher fragte, ob es hier Diesel für „extranjeros“, also für Ausländer gäbe und sage ihm, dass wir uns das sicher nicht gefallen lassen werden. Inzwischen haben wir auch schon die Zapfsäule erreicht und Karl kündigt an, hier einfach so lange stehen zu bleiben, bis wir Diesel bekommen. Eine Nervenprobe! Der Tankwart versucht uns zuerst zu ignorieren, das hält er aber nicht lange durch, denn inzwischen kommen immer mehr der hinter uns wartenden LKW-Fahrer nach vorne um zu fragen warum hier nichts mehr weitergeht. Irgendwann gibt sich der Tankwart dann geschlagen, er führt ein Telefongespräch – wahrscheinlich mit seinem Chef – und erklärt sich im Anschluss daran bereit uns beide Tanks zu füllen, auf keinen Fall aber die Reservekanister. Na super, hätten wir das nur vorher gewusst, dann hätten wir den von den LKW-Fahrern gekauften Diesel nicht in die Tanks umgefüllt…! Aber das lässt sich jetzt eh nicht mehr ändern, so kriegen wir wenigstens die Tanks voll. So schnell geht’s dann aber doch wieder nicht. Umständlich muss der Tankwart erst einmal sein System auf „Touristen“ umstellen, dann müssen noch unsere Reisepassnummern in ein Formular eingetragen werden und uns wird langsam klar, dass es wahrscheinlich hauptsächlich genau diese zusätzliche Arbeit ist, die sich die meisten Tankwarte einfach nicht antun wollen und daher jedesmal von vornhinein abwinken, wenn Touristen auf der Bildfläche erscheinen. Aber immerhin haben wir jetzt erst einmal genug Diesel um weiter in den Süden zu fahren, eine Rückkehr nach Peru und damit ein kompletter Verzicht auf Bolivien kommt für uns nämlich nicht in Frage. Schweren Herzens muss ich mich aber gleichzeitig von meinen Plänen verabschieden, das Hinterland von Bolivien zu erkunden, da wir das aufgrund der verzwickten Diesel-Lage einfach nicht riskieren wollen. So gerne wollte ich bis auf über 5.000 m nach „Chacaltaya“ hinauffahren, wo sich seit 1939 die höchste Schipiste der Welt befand, mit einer Hütte die bis zur Schließung, die 1990 aufgrund des Rückgangs des inzwischen fast zur Gänze abgeschmolzenen Gletschers erfolgen musste, vom österreichischen Alpenverein betrieben wurde. Nichts wird nun auch aus dem Besuch der „Yungas“, dem Amazonas-Tiefland und dem tropischen Regenwald und vergessen kann ich auch, zu meinem großen Leidwesen, den Umweg in das kleine Dorf „La Higuera“ in dem am 9. Oktober 1967 Ernesto „Che“ Guevara vom bolivianischen Militär erschossen wurde. Am leichtesten fällt uns noch der Verzicht auf das Befahren der „Ruta de la muerte“, der Todesstraße, die ohnedies seit Jahren bereits mehr zu einer Touristenaktion geworden ist, für deren Benützung man inzwischen bezahlen muss
Unimog zu schleichen, um dann im Anschluss zu mir ans Fenster zu kommen und mir zu erklären, er habe erst jetzt gesehen, dass wir ja ausländische Kennzeichen hätten und es tue ihm leid, aber er dürfe uns daher nichts verkaufen. Jetzt platzt uns aber beiden der Kragen. Ich frage den Tankwart was so schwer daran zu verstehen war, als ich vorher fragte, ob es hier Diesel für „extranjeros“, also für Ausländer gäbe und sage ihm, dass wir uns das sicher nicht gefallen lassen werden. Inzwischen haben wir auch schon die Zapfsäule erreicht und Karl kündigt an, hier einfach so lange stehen zu bleiben, bis wir Diesel bekommen. Eine Nervenprobe! Der Tankwart versucht uns zuerst zu ignorieren, das hält er aber nicht lange durch, denn inzwischen kommen immer mehr der hinter uns wartenden LKW-Fahrer nach vorne um zu fragen warum hier nichts mehr weitergeht. Irgendwann gibt sich der Tankwart dann geschlagen, er führt ein Telefongespräch – wahrscheinlich mit seinem Chef – und erklärt sich im Anschluss daran bereit uns beide Tanks zu füllen, auf keinen Fall aber die Reservekanister. Na super, hätten wir das nur vorher gewusst, dann hätten wir den von den LKW-Fahrern gekauften Diesel nicht in die Tanks umgefüllt…! Aber das lässt sich jetzt eh nicht mehr ändern, so kriegen wir wenigstens die Tanks voll. So schnell geht’s dann aber doch wieder nicht. Umständlich muss der Tankwart erst einmal sein System auf „Touristen“ umstellen, dann müssen noch unsere Reisepassnummern in ein Formular eingetragen werden und uns wird langsam klar, dass es wahrscheinlich hauptsächlich genau diese zusätzliche Arbeit ist, die sich die meisten Tankwarte einfach nicht antun wollen und daher jedesmal von vornhinein abwinken, wenn Touristen auf der Bildfläche erscheinen. Aber immerhin haben wir jetzt erst einmal genug Diesel um weiter in den Süden zu fahren, eine Rückkehr nach Peru und damit ein kompletter Verzicht auf Bolivien kommt für uns nämlich nicht in Frage. Schweren Herzens muss ich mich aber gleichzeitig von meinen Plänen verabschieden, das Hinterland von Bolivien zu erkunden, da wir das aufgrund der verzwickten Diesel-Lage einfach nicht riskieren wollen. So gerne wollte ich bis auf über 5.000 m nach „Chacaltaya“ hinauffahren, wo sich seit 1939 die höchste Schipiste der Welt befand, mit einer Hütte die bis zur Schließung, die 1990 aufgrund des Rückgangs des inzwischen fast zur Gänze abgeschmolzenen Gletschers erfolgen musste, vom österreichischen Alpenverein betrieben wurde. Nichts wird nun auch aus dem Besuch der „Yungas“, dem Amazonas-Tiefland und dem tropischen Regenwald und vergessen kann ich auch, zu meinem großen Leidwesen, den Umweg in das kleine Dorf „La Higuera“ in dem am 9. Oktober 1967 Ernesto „Che“ Guevara vom bolivianischen Militär erschossen wurde. Am leichtesten fällt uns noch der Verzicht auf das Befahren der „Ruta de la muerte“, der Todesstraße, die ohnedies seit Jahren bereits mehr zu einer Touristenaktion geworden ist, für deren Benützung man inzwischen bezahlen muss  und die zudem täglich von unzähligen, mehr oder minder verrückten, Mountainbikern bevölkert wird, die sich, egal ob geübt oder ungeübt, auf gemieteten Fahrrädern über die enge Straße hinunterstürzen. Beweisen brauchen wir uns in dieser Hinsicht ja sowieso nichts mehr, denn die Straßen und Wege die der Unimog auf dieser Reise bereits bezwungen hat, waren sicher zum Großteil um einiges herausfordernder. Also folgen wir ganz ungewohnt der Hauptstraße in den Süden und planen unseren nächsten Stopp in der Hauptstadt „Sucre“. Auf den Kauf einer Fahrzeugversicherung in „La Paz“ haben wir dann letztendlich ebenfalls verzichtet, denn als wir nach ewigem Stau durch die engen Straßen endlich das Versicherungsbüro gefunden hatten, war es nicht möglich, irgendwo in der Nähe auch nur für kurze Zeit einen Parkplatz zu finden, ich weiß, es klingt unglaublich wenn man das hört, aber diese Stadt und ihr Verkehr sind wirklich grenzwertig, noch nie auf dieser Reise war ich vom Verkehr so genervt wie hier! Also pfeifen wir schließlich drauf und hoffen wieder einmal, dass wir unfallfrei durchkommen, denn die Abzocke die als ausländische KFZ-Besitzer, ohne Versicherung, nach einem Unfall, egal ob von uns verschuldet oder nicht, wohl ganz sicher auf uns zukommen würde, möchten wir uns lieber gar nicht vorstellen. Aber immerhin haben wir uns ja noch vor kurzem mit der „Jungfrau von Copacabana“ und der „Pachamama“ ziemlich gutgestellt – Das hilft doch sicher auch… irgendwie… !
und die zudem täglich von unzähligen, mehr oder minder verrückten, Mountainbikern bevölkert wird, die sich, egal ob geübt oder ungeübt, auf gemieteten Fahrrädern über die enge Straße hinunterstürzen. Beweisen brauchen wir uns in dieser Hinsicht ja sowieso nichts mehr, denn die Straßen und Wege die der Unimog auf dieser Reise bereits bezwungen hat, waren sicher zum Großteil um einiges herausfordernder. Also folgen wir ganz ungewohnt der Hauptstraße in den Süden und planen unseren nächsten Stopp in der Hauptstadt „Sucre“. Auf den Kauf einer Fahrzeugversicherung in „La Paz“ haben wir dann letztendlich ebenfalls verzichtet, denn als wir nach ewigem Stau durch die engen Straßen endlich das Versicherungsbüro gefunden hatten, war es nicht möglich, irgendwo in der Nähe auch nur für kurze Zeit einen Parkplatz zu finden, ich weiß, es klingt unglaublich wenn man das hört, aber diese Stadt und ihr Verkehr sind wirklich grenzwertig, noch nie auf dieser Reise war ich vom Verkehr so genervt wie hier! Also pfeifen wir schließlich drauf und hoffen wieder einmal, dass wir unfallfrei durchkommen, denn die Abzocke die als ausländische KFZ-Besitzer, ohne Versicherung, nach einem Unfall, egal ob von uns verschuldet oder nicht, wohl ganz sicher auf uns zukommen würde, möchten wir uns lieber gar nicht vorstellen. Aber immerhin haben wir uns ja noch vor kurzem mit der „Jungfrau von Copacabana“ und der „Pachamama“ ziemlich gutgestellt – Das hilft doch sicher auch… irgendwie… !
Auf der Fahrt durch das Land habe ich ein ähnliches Gefühl wie damals, als wir von El Salvador nach Honduras eingereist sind. Plötzlich waren alle Farben außer braun und grau wie ausgelöscht. Genauso präsentiert sich uns jetzt Bolivien, das nur aus Sand und Steinen zu bestehen scheint. Selbst die Dörfer,  durch die wir ab und zu kommen, sind da kein Lichtblick. Die Häuser sind aus braunen Ziegelsteinen gebaut die alle unverputzt sind und sich dadurch komplett in das öde Bild der Landschaft einfügen. Alles wirkt irgendwie traurig und
durch die wir ab und zu kommen, sind da kein Lichtblick. Die Häuser sind aus braunen Ziegelsteinen gebaut die alle unverputzt sind und sich dadurch komplett in das öde Bild der Landschaft einfügen. Alles wirkt irgendwie traurig und lieblos, schmerzlich vermisse ich das bunte Peru, wo überall an der Straße kleine Lokale lockten, durchwegs mit einem wunderbaren Angebot an einheimischen Speisen und Getränken. Hier in
lieblos, schmerzlich vermisse ich das bunte Peru, wo überall an der Straße kleine Lokale lockten, durchwegs mit einem wunderbaren Angebot an einheimischen Speisen und Getränken. Hier in  Bolivien gibt es davon nichts, auch in den Ortschaften sieht man nichts anderes als ab und zu am Straßenrand einen Stand der fettige, panierte Hühnerteile mit schon ewig warmgehaltenen Pommes frites verkauft. Das wirklich einzige das Bolivien mit Peru gemeinsam zu haben scheint, ist ein mindestens ebenso großes Müllproblem, denn auch hier türmen sich die Müllberge unaufhörlich entlang der Straßen. Das Mautsystem in diesem Land ist komplett undurchsichtig, um den zu bezahlenden Preis zu ermitteln, wird man immer gefragt wohin man will, was für Overlander wie uns, die manchmal nur eine ungefähre Richtung kennen, oft gar nicht so einfach zu beantworten ist. Manchmal muss man zahlen, ein anderes Mal wird das vorher erhaltene Ticket nur gestempelt, daher heben wir vorsichtshalber einfach mal
Bolivien gibt es davon nichts, auch in den Ortschaften sieht man nichts anderes als ab und zu am Straßenrand einen Stand der fettige, panierte Hühnerteile mit schon ewig warmgehaltenen Pommes frites verkauft. Das wirklich einzige das Bolivien mit Peru gemeinsam zu haben scheint, ist ein mindestens ebenso großes Müllproblem, denn auch hier türmen sich die Müllberge unaufhörlich entlang der Straßen. Das Mautsystem in diesem Land ist komplett undurchsichtig, um den zu bezahlenden Preis zu ermitteln, wird man immer gefragt wohin man will, was für Overlander wie uns, die manchmal nur eine ungefähre Richtung kennen, oft gar nicht so einfach zu beantworten ist. Manchmal muss man zahlen, ein anderes Mal wird das vorher erhaltene Ticket nur gestempelt, daher heben wir vorsichtshalber einfach mal  alles auf was man uns gibt. Die ewige Diskussion an den Mautstellen, dass wir kein „Camion“ kein LKW sondern eine „Casa
alles auf was man uns gibt. Die ewige Diskussion an den Mautstellen, dass wir kein „Camion“ kein LKW sondern eine „Casa  rodante“ ein Wohnmobil sind, weil dafür so ziemlich überall geringere Tarife gelten,
rodante“ ein Wohnmobil sind, weil dafür so ziemlich überall geringere Tarife gelten, setzt sich auch hier, wie schon in den vorigen Ländern, wieder fort und führt meistens zu längeren Wartezeiten vor der Schranke, bis das Hupkonzert hinter
setzt sich auch hier, wie schon in den vorigen Ländern, wieder fort und führt meistens zu längeren Wartezeiten vor der Schranke, bis das Hupkonzert hinter  uns so stark ansteigt, dass die Damen in ihren Mauthäuschen genervt einlenken. Hat man sich dann an einer Mautstelle einmal das günstigere Ticket erkämpft, heißt es dieses aufzuheben und bei allen folgenden vorzuzeigen, was die Prozedur dann meistens um einiges abkürzt. Das letzte Drittel der Fahrt führt dann durch die Berge, die Landschaft wird etwas reizvoller, es öffnen sich fruchtbare Hochtäler, wir sehen riesige Lamaherden neben der Straße, viel mehr als wir in ganz Peru zusammen gesehen haben, wo die Alpacas dominiert haben. Wir bewegen uns weiterhin immer zwischen 3.000 und 4.000 m, die Straße wird enger, sie führt durch tiefe Schluchten und durch unzählige Bergbaudörfer.
uns so stark ansteigt, dass die Damen in ihren Mauthäuschen genervt einlenken. Hat man sich dann an einer Mautstelle einmal das günstigere Ticket erkämpft, heißt es dieses aufzuheben und bei allen folgenden vorzuzeigen, was die Prozedur dann meistens um einiges abkürzt. Das letzte Drittel der Fahrt führt dann durch die Berge, die Landschaft wird etwas reizvoller, es öffnen sich fruchtbare Hochtäler, wir sehen riesige Lamaherden neben der Straße, viel mehr als wir in ganz Peru zusammen gesehen haben, wo die Alpacas dominiert haben. Wir bewegen uns weiterhin immer zwischen 3.000 und 4.000 m, die Straße wird enger, sie führt durch tiefe Schluchten und durch unzählige Bergbaudörfer.
Bolivien ist eines der an Rohstoffen reichsten Länder Südamerikas. Es wird unter anderem Kohle, Eisenerz, Kupfer, Zink, Blei und Wolfram genauso gefördert wie Gold und Silber. Auch High-Tech-Rohstoffe wie Gallium und Iridium werden abgebaut, die Erdgasvorkommen sind die zweitgrößten nach Venezuela und das Land verfügt über die größte Zinnlagerstätte der Welt. Einen besonderen Reichtum stellt zusätzlich der „Salar de Uyuni“ dar. Neben den ca. 25.000 t Salz, die hier pro Jahr gefördert und zu 95% zu Speisesalz verarbeitet werden, liegt darunter das weltweit größte Lithiumvorkommen, man spricht von etwa 40% der vorhandenen Weltressourcen, was Bolivien zu einem sehr reichen Land machen könnte. Viele der Minen und Abbaustätten, die sich vorher in der Hand ausländischer Konzerne befanden, wurden, ebenso wie die Ölkonzerne, 2006 nach der Wahl des ersten indidigenen Präsidenten und anschließenden „Langzeitherrschers“ Evo Morales verstaatlicht und der Präsident gab als Parole für eine Zusammenarbeit mit ausländischen Investoren die Parole „Partner nicht Herren“ aus. Wie so oft war aber auch hier „gut gemeint“ nicht „gut gemacht“. Insbesonders bei dem Abbau des Lithiums wollte Bolivien weitgehend auf ausländische Hilfe verzichten, sehr schnell stellte sich aber heraus, dass sich das, aufgrund des fehlenden technischen Know-Hows im eigenen Land, so nicht durchführen lassen würde. Nun, wer hat dabei wohl sehr gerne ausgeholfen? Richtig, wiederum sind es die Chinesen, die inzwischen den größten Teil des Lithiums hier fördern, was dabei für Bolivien, bzw. insbesonders für dessen Bevölkerung, übrigbleibt kann man sich gut vorstellen. Nach wie vor hat es keine der bisherigen Regierungen geschafft, das Land mit einer ordentlichen, dringend benötigten Infrastruktur auszustatten, es fehlt hinten und vorne an Strom- und Wasserversorgung sowie an einem ordentlichen Straßennetz und bereits seit Jahren an genügend Treibstoff für die Wirtschaft. Was nützt es Firmen wenn sie vom Staat subventionierten Diesel bekommen, wenn die LKW-Fahrer dann täglich viele Stunden ihrer Arbeitszeit in den langen Schlangen vor den Tankstellen zubringen müssen? Das alles und natürlich die allgegenwärtige Korruption sorgen dafür, dass das Land und damit seine Bevölkerung trotz seines Reichtums an Bodenschätzen zu den Ärmsten auf dem amerikanischen Kontinent zählt. Das alles macht die Einheimischen natürlich unglaublich wütend und man hört, egal ob man mit Unternehmern, mit Bergbauarbeitern oder mit Reiseleitern spricht, immer wieder die gleichen Stimmen, nämlich dass eben „links und liberal“ alleine nicht wirklich genügt um einem Volk Wohlstand zu bescheren. Es darf daher wohl niemanden wundern, dass derzeit auch in Südamerika die rechtsorientierten Parteien immer mehr Zuspruch erhalten. Ob sich dadurch ihre Situation dann zum Besseren ändert, ist natürlich eine andere Geschichte.
Unsere Fahrt nach „Sucre“, der wahrscheinlich einzigen Hauptstadt der Welt ohne Regierungssitz, verlangt Karl am Schluss dann noch einiges ab. Das Wetter schlägt plötzlich um und durch den einsetzenden Starkregen lösen sich immer wieder Steine und Felsbrocken von den Steilwänden neben der Straße  und prasseln auf die Fahrbahn, sodass wir im Dunkeln oft nur im letzten Moment ausweichen können. Jeden Moment rechnen wir damit, dass ein Stein unseren Unimog trifft und wir sind daher heilfroh als wir endlich – und Gott sei Dank ohne Schaden – in „Sucre“ ankommen. Wir haben uns als Standort ausnahmsweise einen kleinen Campingplatz mitten in der Stadt ausgesucht, da die Besitzer in Overlander-Kreisen als sehr freundlich und hilfsbereit bekannt sind und wir daher hoffen, dass sie uns eventuell dabei behilflich sein können, doch noch an Diesel für unsere Reservekanister zu kommen. Obwohl wir durch das schlechte Wetter mit großer
und prasseln auf die Fahrbahn, sodass wir im Dunkeln oft nur im letzten Moment ausweichen können. Jeden Moment rechnen wir damit, dass ein Stein unseren Unimog trifft und wir sind daher heilfroh als wir endlich – und Gott sei Dank ohne Schaden – in „Sucre“ ankommen. Wir haben uns als Standort ausnahmsweise einen kleinen Campingplatz mitten in der Stadt ausgesucht, da die Besitzer in Overlander-Kreisen als sehr freundlich und hilfsbereit bekannt sind und wir daher hoffen, dass sie uns eventuell dabei behilflich sein können, doch noch an Diesel für unsere Reservekanister zu kommen. Obwohl wir durch das schlechte Wetter mit großer  Verspätung ankommen, haben Vater und Sohn tatsächlich noch auf uns gewartet und helfen uns, den Unimog durch das schmale Einfahrtstor zu manöverieren. Sohn Luis hat 15 Jahre in Hamburg gearbeitet und spricht daher perfekt deutsch, und wir fühlen uns sofort total wohl auf dem winzigen Platz, auf dem nicht mehr als vielleicht vier oder fünf Fahrzeuge oder Zelte Platz haben. Außer uns steht bei unserer Ankunft nur ein großer Mercedes-Truck mit deutschem Kennzeichen im Hof und schon am nächsten Tag lernen wir das dazugehörige
Verspätung ankommen, haben Vater und Sohn tatsächlich noch auf uns gewartet und helfen uns, den Unimog durch das schmale Einfahrtstor zu manöverieren. Sohn Luis hat 15 Jahre in Hamburg gearbeitet und spricht daher perfekt deutsch, und wir fühlen uns sofort total wohl auf dem winzigen Platz, auf dem nicht mehr als vielleicht vier oder fünf Fahrzeuge oder Zelte Platz haben. Außer uns steht bei unserer Ankunft nur ein großer Mercedes-Truck mit deutschem Kennzeichen im Hof und schon am nächsten Tag lernen wir das dazugehörige , überaus symphatische Paar Willi und Ria kennen, mit denen wir uns sofort sehr gut verstehen. Damit wir neben den deutschen Truck unter die Bäume passen, müssen Luis und sein Team erst einige tiefhängende Äste abschneiden, aber dann haben wir hier den perfekten Standplatz. Länger als geplant, nämlich vier Nächte, verbringen wir dann auf dem gemütlichen Platz, der perfekt in Gehweite zum wunderschönen Zentrum der Stadt mit seinen vielen Geschäften, Cafés, Bars und Restaurants liegt. „Sucre“ wird durch ihre vielen weißen und gut erhaltenen Kolonialgebäude auch oft „die weiße Stadt“ genannt und nach dem Chaos von „La Paz“ ist es eine echte Erholung durch ihre kleinen Gassen zu schlendern. Karl macht sich mit Luis zweimal auf den Weg zu einer Tankstelle an der man durch Luis‘ Vermittlung tatsächlich jeweils zwei unserer Kanister mit Diesel füllt. Beim zweiten Mal hat aber dann sogar Luis große Mühe, den Tankwart zu bewegen, nocheinmal 40 l herauszurücken, weil dieser sich erinnert, dass die beiden schon am Vortag mit zwei Kanistern da waren und es selbst für Einheimische ein Limit von 60 l pro Monat gibt, wenn es um die Füllung von Kanistern mit Diesel geht, um privaten Treibstoffhandel zu unterbinden. Letztendlich klappt es aber dann doch und wir sind wahnsinnig froh und Luis unendlich dankbar, denn ohne seine Hilfe hätten wir wohl keine Chance gehabt, die Kanister zu füllen oder zumindestens hätten wir dafür viel mehr Zeit und Nerven gebraucht. Von unseren deutschen Platznachbarn hören wir Ähnliches, sie haben mit ihrem Truck natürlich genau die gleichen Probleme und es auch nur mit großer Mühe und oft viel Glück geschafft, bisher in Bolivien an Diesel zu kommen, was sie mindestens genauso aufregt wie uns.
, überaus symphatische Paar Willi und Ria kennen, mit denen wir uns sofort sehr gut verstehen. Damit wir neben den deutschen Truck unter die Bäume passen, müssen Luis und sein Team erst einige tiefhängende Äste abschneiden, aber dann haben wir hier den perfekten Standplatz. Länger als geplant, nämlich vier Nächte, verbringen wir dann auf dem gemütlichen Platz, der perfekt in Gehweite zum wunderschönen Zentrum der Stadt mit seinen vielen Geschäften, Cafés, Bars und Restaurants liegt. „Sucre“ wird durch ihre vielen weißen und gut erhaltenen Kolonialgebäude auch oft „die weiße Stadt“ genannt und nach dem Chaos von „La Paz“ ist es eine echte Erholung durch ihre kleinen Gassen zu schlendern. Karl macht sich mit Luis zweimal auf den Weg zu einer Tankstelle an der man durch Luis‘ Vermittlung tatsächlich jeweils zwei unserer Kanister mit Diesel füllt. Beim zweiten Mal hat aber dann sogar Luis große Mühe, den Tankwart zu bewegen, nocheinmal 40 l herauszurücken, weil dieser sich erinnert, dass die beiden schon am Vortag mit zwei Kanistern da waren und es selbst für Einheimische ein Limit von 60 l pro Monat gibt, wenn es um die Füllung von Kanistern mit Diesel geht, um privaten Treibstoffhandel zu unterbinden. Letztendlich klappt es aber dann doch und wir sind wahnsinnig froh und Luis unendlich dankbar, denn ohne seine Hilfe hätten wir wohl keine Chance gehabt, die Kanister zu füllen oder zumindestens hätten wir dafür viel mehr Zeit und Nerven gebraucht. Von unseren deutschen Platznachbarn hören wir Ähnliches, sie haben mit ihrem Truck natürlich genau die gleichen Probleme und es auch nur mit großer Mühe und oft viel Glück geschafft, bisher in Bolivien an Diesel zu kommen, was sie mindestens genauso aufregt wie uns.
„Näher am Himmel“ und „Besuch beim Onkel unter der Erde“
Unser nächstes Ziel auf unserer gezwungenermaßen verkürzten Reise durch Bolivien ist auf jeden Fall die auf 4.090 m gelegene Silberstadt „Potosí“, die durch die Jahrhunderte hindurch viele Superlativen erlangte. Im 17. Jahrhundert war sie eine der größten Städte der Welt, die Stadt mit der größten industriellen Anlage der Welt und einmal sogar die reichste Stadt der Welt. Heute ist sie immerhin noch die höchstgelegene Großstadt der Welt, daher hat sie auch ihren  Beinamen „Potosí – eine Stadt näher am Himmel“, jedoch mit einer inzwischen mehrheitlich armen Bevölkerung. Schon vor den Spaniern bauten die Inkas und andere indigene Völker das damals noch knapp unter der Oberfläche liegende Silber aus dem, die Stadt hoch überragenden Berg, dem „Cerro Rico“, ab und huldigten damit ihren Göttern. Zur Zeit der spanischen Herrschaft fand man heraus, dass der Schatz des Berges einfach unermesslich war und es wurde umgehend begonnen, vor allem das Silber professionell abzubauen. Die Stadt erblühte, zwischen 1650 und 1675 kamen zwei Drittel des Weltsilbers aus Potosí, an Festtagen wurden Teile der Straßen mit Silber gepflastert, architektonisch und kulturell gab es zu jener Zeit in diesem Teil der Welt kaum etwas Vergleichbares. 36 prunkvolle Kirchen, Klöster, Casinos, Tanzpaläste boten Besinnung, Luxus und Vergnügen für das bunte Publikum von Bergleuten, Soldaten, Priestern, Adeligen, Dirnen und Künstlern. Wenn man heute, wie wir, nach Potosi kommt, kann man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen. Die Stadt, die inzwischen ca. 200.000 Einwohner zählt, wirkt grau und farblos vor dem hinter ihr in den tiefblauen Himmel ragenden „Cerro Rico“ der nach 500 Jahren Bergbau inzwischen von mehr als 1.000 Minenschächten durchzogen ist. Sie wurde zwar 1987 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt, jedoch scheint hinten und vorne das Geld zu fehlen, um die noch übrigen kolonialen Gebäude, an denen der Zahn der Zeit heftig nagt, auch nur im Ansatz zu erhalten. Der Großteil der Bewohner verdient auch heute noch ihr Geld im Bergbau, auch wenn die Ausbeute inzwischen sehr gering ist und die Arbeitsbedingungen kaum besser sind als zu den Anfangszeiten. Karl, der seine Grippe leider verschleppt hat und dadurch immer noch nicht ganz fit ist, schläft erst einmal wieder zwei Tage lang, derweil durchstreife ich alleine die engen Gassen der
Beinamen „Potosí – eine Stadt näher am Himmel“, jedoch mit einer inzwischen mehrheitlich armen Bevölkerung. Schon vor den Spaniern bauten die Inkas und andere indigene Völker das damals noch knapp unter der Oberfläche liegende Silber aus dem, die Stadt hoch überragenden Berg, dem „Cerro Rico“, ab und huldigten damit ihren Göttern. Zur Zeit der spanischen Herrschaft fand man heraus, dass der Schatz des Berges einfach unermesslich war und es wurde umgehend begonnen, vor allem das Silber professionell abzubauen. Die Stadt erblühte, zwischen 1650 und 1675 kamen zwei Drittel des Weltsilbers aus Potosí, an Festtagen wurden Teile der Straßen mit Silber gepflastert, architektonisch und kulturell gab es zu jener Zeit in diesem Teil der Welt kaum etwas Vergleichbares. 36 prunkvolle Kirchen, Klöster, Casinos, Tanzpaläste boten Besinnung, Luxus und Vergnügen für das bunte Publikum von Bergleuten, Soldaten, Priestern, Adeligen, Dirnen und Künstlern. Wenn man heute, wie wir, nach Potosi kommt, kann man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen. Die Stadt, die inzwischen ca. 200.000 Einwohner zählt, wirkt grau und farblos vor dem hinter ihr in den tiefblauen Himmel ragenden „Cerro Rico“ der nach 500 Jahren Bergbau inzwischen von mehr als 1.000 Minenschächten durchzogen ist. Sie wurde zwar 1987 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt, jedoch scheint hinten und vorne das Geld zu fehlen, um die noch übrigen kolonialen Gebäude, an denen der Zahn der Zeit heftig nagt, auch nur im Ansatz zu erhalten. Der Großteil der Bewohner verdient auch heute noch ihr Geld im Bergbau, auch wenn die Ausbeute inzwischen sehr gering ist und die Arbeitsbedingungen kaum besser sind als zu den Anfangszeiten. Karl, der seine Grippe leider verschleppt hat und dadurch immer noch nicht ganz fit ist, schläft erst einmal wieder zwei Tage lang, derweil durchstreife ich alleine die engen Gassen der  Stadt, deren eigenen Charme man wirklich schwer suchen muss. Es ist hier alles „echt bolivianisch“ und ernst blickt dazu der Langzeitheld und Namenspatron des Landes „Simon Bolivar“ von seinem Denkmal herab. Winzige Läden mit Lebensmitteln wechseln sich ab mit Straßenhändlern, zum Essen gibt es aber wieder nur Stände mit fettigen Hamburgern, Pommes frites und den mir inzwischen echt zum Hals heraushängenden
Stadt, deren eigenen Charme man wirklich schwer suchen muss. Es ist hier alles „echt bolivianisch“ und ernst blickt dazu der Langzeitheld und Namenspatron des Landes „Simon Bolivar“ von seinem Denkmal herab. Winzige Läden mit Lebensmitteln wechseln sich ab mit Straßenhändlern, zum Essen gibt es aber wieder nur Stände mit fettigen Hamburgern, Pommes frites und den mir inzwischen echt zum Hals heraushängenden  panierten Hühnerteilen. Einziger Lichtblick sind ein paar einfache, winzige Einheimischenlokale, ausgestattet mit drei, vier rustikalen Holztischen, die z.B. ausgezeichnete Suppen anbieten, aber allesamt zu meinem Entsetzen nicht einmal ein Klo haben. Hier kann man allerdings wirklich sehr gut und so extrem günstig essen wie noch nirgends zuvor auf unserer Reise, das heißt, sofern man
panierten Hühnerteilen. Einziger Lichtblick sind ein paar einfache, winzige Einheimischenlokale, ausgestattet mit drei, vier rustikalen Holztischen, die z.B. ausgezeichnete Suppen anbieten, aber allesamt zu meinem Entsetzen nicht einmal ein Klo haben. Hier kann man allerdings wirklich sehr gut und so extrem günstig essen wie noch nirgends zuvor auf unserer Reise, das heißt, sofern man  dann, nach einem Besuch der spärlichen öffentlichen WC-Anlagen, die allesamt in erbärmlichem Zustand sind und ohne
dann, nach einem Besuch der spärlichen öffentlichen WC-Anlagen, die allesamt in erbärmlichem Zustand sind und ohne  fließendes Wasser auskommen, überhaupt noch Appetit hat… . Als „Bosse“ in den Lokalen und Straßenküchen dominieren vorwiegend gestandene, bolivianische Damen, achtungsvoll „Cholitas“ genannt, deren Kleidung aus der „Pollera“, einem Überrock mit bis zu zehn Unterröcken besteht, die sie durchwegs als rundlich bis übergewichtig erscheinen lassen. Ihr Markenzeichen ist der runde Hut, der an eine englische „Melone“ erinnert. Dieser wurde in den 1920er Jahren von europäischen Einwanderern ins Land gebracht, erwies sich hier aber unter der sengenden Sonne durch die schmale Krempe als nicht besonders hilfreich und wurde daher vielfach an die Damenwelt verschenkt, wo er sich bis heute erhalten hat. Die Fußgängerzone von Potosí ist winzig und an Geschäften überwiegen billige Läden in denen großteils gebrauchte, amerikanischen Klamotten verkauft werden sowie Handys und
fließendes Wasser auskommen, überhaupt noch Appetit hat… . Als „Bosse“ in den Lokalen und Straßenküchen dominieren vorwiegend gestandene, bolivianische Damen, achtungsvoll „Cholitas“ genannt, deren Kleidung aus der „Pollera“, einem Überrock mit bis zu zehn Unterröcken besteht, die sie durchwegs als rundlich bis übergewichtig erscheinen lassen. Ihr Markenzeichen ist der runde Hut, der an eine englische „Melone“ erinnert. Dieser wurde in den 1920er Jahren von europäischen Einwanderern ins Land gebracht, erwies sich hier aber unter der sengenden Sonne durch die schmale Krempe als nicht besonders hilfreich und wurde daher vielfach an die Damenwelt verschenkt, wo er sich bis heute erhalten hat. Die Fußgängerzone von Potosí ist winzig und an Geschäften überwiegen billige Läden in denen großteils gebrauchte, amerikanischen Klamotten verkauft werden sowie Handys und  chinesisches Elektronikzubehör. Einen eigenen Fernseher scheinen hier noch weitaus nicht alle Einwohner zu haben, denn Fußball wird hier noch gemeinschaftlich auf der Straße geschaut, nein, nicht gemütlich beim „Public viewing“, sondern stehend, vor dem örtlichen Elektronikgeschäft, das das Spiel auf einem im Schaufenster befindlichen Fernseher überträgt. Ich finde im Zentrum nicht ein einziges, richtiges Café, wlan ist sowieso Fehlanzeige. Ja, klar, dort wo der Tourismus völlig fehlt, müssen sich die Geschäftsleute natürlich an den Bedürfnissen der Einheimischen orientieren. Alles in allem ist Potosí aber keine Stadt in die ich unbedingt noch ein zweites Mal zurückkehren müsste.
chinesisches Elektronikzubehör. Einen eigenen Fernseher scheinen hier noch weitaus nicht alle Einwohner zu haben, denn Fußball wird hier noch gemeinschaftlich auf der Straße geschaut, nein, nicht gemütlich beim „Public viewing“, sondern stehend, vor dem örtlichen Elektronikgeschäft, das das Spiel auf einem im Schaufenster befindlichen Fernseher überträgt. Ich finde im Zentrum nicht ein einziges, richtiges Café, wlan ist sowieso Fehlanzeige. Ja, klar, dort wo der Tourismus völlig fehlt, müssen sich die Geschäftsleute natürlich an den Bedürfnissen der Einheimischen orientieren. Alles in allem ist Potosí aber keine Stadt in die ich unbedingt noch ein zweites Mal zurückkehren müsste.
Es ist aber sowieso nicht die Stadt selbst die mich hierher gelockt hat, ich habe vor Jahren bei einem Vortrag des „Gosingers Helmut Pichler“ von den Minen von „Potosí“ gehört und daher will ich diese jetzt auch mit eigenen Augen sehen. Karl entscheidet sich dann kurzfristig doch noch dazu, ebenfalls mitzukommen und wir werden  ganz bequem „bei uns zu Hause“ das heißt in der Straße in der wir mit dem Unimog parken, von unserem Guide und einem Fahrer in einem winzigen, uralten Auto abgeholt. Wilson arbeitet selbst in den Minen und so oft sich ein paar der der spärlichen Touristen hierher verirren und an ihn weitervermittelt werden, führt er diese gerne durch die Stollen. Als erstes fährt
ganz bequem „bei uns zu Hause“ das heißt in der Straße in der wir mit dem Unimog parken, von unserem Guide und einem Fahrer in einem winzigen, uralten Auto abgeholt. Wilson arbeitet selbst in den Minen und so oft sich ein paar der der spärlichen Touristen hierher verirren und an ihn weitervermittelt werden, führt er diese gerne durch die Stollen. Als erstes fährt  er mit uns zum „Mercado de mineros“, also zu jenem Markt in dem sich die Minenarbeiter mit allem versorgen was sie so brauchen. Das Angebot an den Ständen reicht von Getränken über Werkzeug bis hin zu Dynamit und anderem
er mit uns zum „Mercado de mineros“, also zu jenem Markt in dem sich die Minenarbeiter mit allem versorgen was sie so brauchen. Das Angebot an den Ständen reicht von Getränken über Werkzeug bis hin zu Dynamit und anderem Sprengstoff und natürlich dem Allerwichtigsten, den Kokablättern, die sich die Arbeiter vor Schichtbeginn in eine oder beide Backen schieben und durch deren Wirkstoffe sie zu höherer Leistung fähig sind,
Sprengstoff und natürlich dem Allerwichtigsten, den Kokablättern, die sich die Arbeiter vor Schichtbeginn in eine oder beide Backen schieben und durch deren Wirkstoffe sie zu höherer Leistung fähig sind,  da sie dadurch weder Müdigkeit, Hunger oder Durst verspüren. Auch Flaschen in verschiedenen Größen mit 96%igem Alkohol werden hier verkauft und Wilson erzählt uns, dass dieser von vielen Arbeitern tatsächlich getrunken wird. Wenn man die Minen besucht, ist es üblich, wenn auch freiwillig, an diesen Ständen etwas für die Mineure zu kaufen und so nehmen auch wir einige 2l Flaschen mit Orangensaft und Cola und natürlich ein paar gut gefüllte Säcke mit Cocablättern mit. Die Mitnahme des hochprozentigen Alkohols für seine Kollegen lehnt Wilson ab, zu viele seiner Freunde hätten sich damit bereits erbärmlich zugrunde gerichtet, sagt er uns. Aber auch ohne mit Hochprozentigem nachzuhelfen, hätten die Bergmänner hier ohnedies nur eine Lebenserwartung von durchschnittlich 60 Jahren, dabei würden ein Drittel der Arbeiter an Unfällen und der Rest an Lungenerkrankungen sterben. Obwohl die Arbeit für Kinder und Jugendliche seit ein paar Jahren offiziell verboten ist, sollen immer noch bis zu 500 von ihnen jeden Tag in den unzähligen Stollen unterwegs sein, obwohl Wilson meiner Frage dazu gekonnt ausweicht. Es gibt Arbeiter die mit meist schlechten
da sie dadurch weder Müdigkeit, Hunger oder Durst verspüren. Auch Flaschen in verschiedenen Größen mit 96%igem Alkohol werden hier verkauft und Wilson erzählt uns, dass dieser von vielen Arbeitern tatsächlich getrunken wird. Wenn man die Minen besucht, ist es üblich, wenn auch freiwillig, an diesen Ständen etwas für die Mineure zu kaufen und so nehmen auch wir einige 2l Flaschen mit Orangensaft und Cola und natürlich ein paar gut gefüllte Säcke mit Cocablättern mit. Die Mitnahme des hochprozentigen Alkohols für seine Kollegen lehnt Wilson ab, zu viele seiner Freunde hätten sich damit bereits erbärmlich zugrunde gerichtet, sagt er uns. Aber auch ohne mit Hochprozentigem nachzuhelfen, hätten die Bergmänner hier ohnedies nur eine Lebenserwartung von durchschnittlich 60 Jahren, dabei würden ein Drittel der Arbeiter an Unfällen und der Rest an Lungenerkrankungen sterben. Obwohl die Arbeit für Kinder und Jugendliche seit ein paar Jahren offiziell verboten ist, sollen immer noch bis zu 500 von ihnen jeden Tag in den unzähligen Stollen unterwegs sein, obwohl Wilson meiner Frage dazu gekonnt ausweicht. Es gibt Arbeiter die mit meist schlechten  Werkzeugen für sich privat schürfen, genauso wie andere die für Kollektiven arbeiten, gemeinsam haben sie alle nur den einen Traum
Werkzeugen für sich privat schürfen, genauso wie andere die für Kollektiven arbeiten, gemeinsam haben sie alle nur den einen Traum , irgendwann doch noch auf die große Silber- oder Goldader zu stoßen. Nach einer Berechnung von deutschen Wissenschaftlern, die den „Cerro Rico“ lange untersucht haben, soll es noch für die nächsten 15-25 Jahre Vorkommen geben, die einen Abbau lohnen. Nach unserem Besuch auf dem Markt erhalten wir von Wilson Schutzkleidung und Helme mit Stirnlampen und los geht die Führung hinein in einen
, irgendwann doch noch auf die große Silber- oder Goldader zu stoßen. Nach einer Berechnung von deutschen Wissenschaftlern, die den „Cerro Rico“ lange untersucht haben, soll es noch für die nächsten 15-25 Jahre Vorkommen geben, die einen Abbau lohnen. Nach unserem Besuch auf dem Markt erhalten wir von Wilson Schutzkleidung und Helme mit Stirnlampen und los geht die Führung hinein in einen der Stollen. Über dem Eingang sehen wir einige in der Sonne trocknende, fürchterlich stinkende Lamahäute und Wilson erzählt uns, dass Lamas in regelmäßigen Abständen von den Mineros hier geschlachtet und das Blut anschließend als Opfer für die „Pachamama“ auf dem Boden in den Stollen verteilt werde, um dadurch ihren Schutz für die Bergleute und Erfolg bei der Edelmetallsuche zu erbitten. Wilson ermahnt uns, während der gesamten Führung immer dicht hinter ihm zu bleiben. Es gibt hier keine eigenen Besucherstollen, überall wo wir heute hingehen werden, wird im Vollbetrieb gearbeitet. Schienen durchziehen die engen und niedrigen Stollen
der Stollen. Über dem Eingang sehen wir einige in der Sonne trocknende, fürchterlich stinkende Lamahäute und Wilson erzählt uns, dass Lamas in regelmäßigen Abständen von den Mineros hier geschlachtet und das Blut anschließend als Opfer für die „Pachamama“ auf dem Boden in den Stollen verteilt werde, um dadurch ihren Schutz für die Bergleute und Erfolg bei der Edelmetallsuche zu erbitten. Wilson ermahnt uns, während der gesamten Führung immer dicht hinter ihm zu bleiben. Es gibt hier keine eigenen Besucherstollen, überall wo wir heute hingehen werden, wird im Vollbetrieb gearbeitet. Schienen durchziehen die engen und niedrigen Stollen  und immer wenn man aus der Ferne ein anschwellendes Grollen hört, zieht uns Wilson schnell in eine der wenigen Nischen wo die Stollen um ca. 30 cm breiter sind als normal und schon donnern die Loren,
und immer wenn man aus der Ferne ein anschwellendes Grollen hört, zieht uns Wilson schnell in eine der wenigen Nischen wo die Stollen um ca. 30 cm breiter sind als normal und schon donnern die Loren, in denen das Gestein nach draußen transportiert wird, an uns vorbei. Diese werden jeweils von zwei jungen Männern im Laufschritt durch die Stollen geschoben und da diese dafür ihr ganzes Gewicht einsetzen müssen und dadurch nur nach unten schauen, sehen sie nicht was sich auf den Schienen vor ihnen abspielt und würden uns somit ungebremst überfahren. Oft bleiben nur Zentimeter zwischen uns und den Loren. Gebückte Haltung ist während der gesamten Tour sowieso vorausgesetzt, für Menschen mit Klaustrophobie ist diese Besichtigung auf jeden Fall ungeeignet. Immer wieder gehen Stollen in alle Richtungen ab und oft enden
in denen das Gestein nach draußen transportiert wird, an uns vorbei. Diese werden jeweils von zwei jungen Männern im Laufschritt durch die Stollen geschoben und da diese dafür ihr ganzes Gewicht einsetzen müssen und dadurch nur nach unten schauen, sehen sie nicht was sich auf den Schienen vor ihnen abspielt und würden uns somit ungebremst überfahren. Oft bleiben nur Zentimeter zwischen uns und den Loren. Gebückte Haltung ist während der gesamten Tour sowieso vorausgesetzt, für Menschen mit Klaustrophobie ist diese Besichtigung auf jeden Fall ungeeignet. Immer wieder gehen Stollen in alle Richtungen ab und oft enden diese dann vor einem meist ungesicherten, goßen Loch, denn auch vertikal sprengen die Mineros ihre Stollen, die dann oft 30-40 m nach unten führen, kein Lichtstrahl erreicht hier mehr den Boden. Immer heisser wird es, je weiter Wilson uns in den „Cerro Rico“ hineinführt. In einem der Stollen präsentiert er uns dann eine Art Altar rund um eine Figur die „Tio“ genannt wird, eine Gestalt die erst von den
diese dann vor einem meist ungesicherten, goßen Loch, denn auch vertikal sprengen die Mineros ihre Stollen, die dann oft 30-40 m nach unten führen, kein Lichtstrahl erreicht hier mehr den Boden. Immer heisser wird es, je weiter Wilson uns in den „Cerro Rico“ hineinführt. In einem der Stollen präsentiert er uns dann eine Art Altar rund um eine Figur die „Tio“ genannt wird, eine Gestalt die erst von den  Spaniern als Gottheit eingeführt wurde. Sie hatten diesen den Indios als „Dios“, was der spanische
Spaniern als Gottheit eingeführt wurde. Sie hatten diesen den Indios als „Dios“, was der spanische  Name für Gott ist, präsentiert und ihnen mit seiner Vergeltung im Fall von schlechter oder langsamer Arbeit gedroht. Da die Indios dieses Wort aber nie richtig aussprechen konnten, wurde es eben mit der Zeit zu „Tio“, was auf spanisch Onkel bedeutet. Der Respekt vor der Gestalt ist jedoch geblieben und jeden ersten und letzten Freitag im Monat kommen die Arbeiter vor ihrer an diesem Tag üblichen Doppelschicht auch heute noch hierher um „Tio“ Cocablätter, Alkohol und Zigaretten zu opfern und um dadurch seinen Schutz und seine Hilfe zu erbitten. Auch Wilson hat Zigaretten und ein Fläschchen mit dem 96%igen Schnaps dabei, lässt dieses aber erst einmal zwischen uns dreien rundum gehen, was Karl zu der Aussage bewegt, dass das wohl auch noch seine letzten verbliebenen Grippeviren abtöten werde und dann teilt Wilson den Rest zwischen „Tio“ und der „Pachamama“ auf, für die er einen Teil auf
Name für Gott ist, präsentiert und ihnen mit seiner Vergeltung im Fall von schlechter oder langsamer Arbeit gedroht. Da die Indios dieses Wort aber nie richtig aussprechen konnten, wurde es eben mit der Zeit zu „Tio“, was auf spanisch Onkel bedeutet. Der Respekt vor der Gestalt ist jedoch geblieben und jeden ersten und letzten Freitag im Monat kommen die Arbeiter vor ihrer an diesem Tag üblichen Doppelschicht auch heute noch hierher um „Tio“ Cocablätter, Alkohol und Zigaretten zu opfern und um dadurch seinen Schutz und seine Hilfe zu erbitten. Auch Wilson hat Zigaretten und ein Fläschchen mit dem 96%igen Schnaps dabei, lässt dieses aber erst einmal zwischen uns dreien rundum gehen, was Karl zu der Aussage bewegt, dass das wohl auch noch seine letzten verbliebenen Grippeviren abtöten werde und dann teilt Wilson den Rest zwischen „Tio“ und der „Pachamama“ auf, für die er einen Teil auf den Boden schüttet. Wir besuchen noch ein paar Arbeiter, die uns dabei gerne auch ihre Funde präsentieren, verteilen zwischendurch immer wieder unsere mitgebrachten Geschenke an
den Boden schüttet. Wir besuchen noch ein paar Arbeiter, die uns dabei gerne auch ihre Funde präsentieren, verteilen zwischendurch immer wieder unsere mitgebrachten Geschenke an die erfreuten Mineros und begeben uns dann wieder an die Oberfläche. Zum
die erfreuten Mineros und begeben uns dann wieder an die Oberfläche. Zum Schluss der Tour zeigt uns Wilson dann noch die „Raffinerie“ wie er es nennt. Hier wird das
Schluss der Tour zeigt uns Wilson dann noch die „Raffinerie“ wie er es nennt. Hier wird das  Gestein von den Mineros angekauft, erst aussortiert, dann zwischen riesigen Steinen zu Pulver vermahlen und dann folgt der absolute Wahnsinn: Wir betreten ein Gebäude, in dem das Gesteinspulver mit Wasser und Chemikalien, darunter Quecksilber, vermischt wird und dabei in mehreren Prozessen die Edelmetalle von den Schlacken getrennt werden. Wir werden mehrmals gewarnt, hier auf keinen Fall etwas anzufassen und die an uns vorher übergebenen Atemmasken aufzusetzen. Überall brodelt und schäumt es, auf meine mehrmalige Frage an Wilson
Gestein von den Mineros angekauft, erst aussortiert, dann zwischen riesigen Steinen zu Pulver vermahlen und dann folgt der absolute Wahnsinn: Wir betreten ein Gebäude, in dem das Gesteinspulver mit Wasser und Chemikalien, darunter Quecksilber, vermischt wird und dabei in mehreren Prozessen die Edelmetalle von den Schlacken getrennt werden. Wir werden mehrmals gewarnt, hier auf keinen Fall etwas anzufassen und die an uns vorher übergebenen Atemmasken aufzusetzen. Überall brodelt und schäumt es, auf meine mehrmalige Frage an Wilson was denn mit dem Abwasser im Anschluss passiere, erhalte ich keine wirklich aussagekräftige Antwort – Was wohl heißt, dass dieses ohne großartige Klärung in die Landschaft entsorgt wird. Wilson erzählt uns dann noch, dass die Anlage oft stillstehe, weil sie einen enormen
was denn mit dem Abwasser im Anschluss passiere, erhalte ich keine wirklich aussagekräftige Antwort – Was wohl heißt, dass dieses ohne großartige Klärung in die Landschaft entsorgt wird. Wilson erzählt uns dann noch, dass die Anlage oft stillstehe, weil sie einen enormen  Wasserverbrauch hätte und die ganze Gegend unter riesigen Problemen durch die vorherrschende Wasserknappheit zu leiden hätte. Während der Trockenzeit gäbe es, um den Betrieb der Anlage halbwegs aufrecht zu erhalten, für die unterhalb liegende Stadt und deren
Wasserverbrauch hätte und die ganze Gegend unter riesigen Problemen durch die vorherrschende Wasserknappheit zu leiden hätte. Während der Trockenzeit gäbe es, um den Betrieb der Anlage halbwegs aufrecht zu erhalten, für die unterhalb liegende Stadt und deren Einwohner oft nur nur eine einzige Stunde Wasser pro Tag. Unsere Führung ist damit beendet und wir bedanken uns bei Wilson und unserem Fahrer natürlich mit einem guten Trinkgeld. Auch hier hören wir wieder, dass es so wichtig für die Region und die Menschen wäre, wenn mehr Touristen ins Land kämen, dass es aber von der Regierung hierzu keinerlei Aktivitäten gäbe. So sind die Menschen, die sich wie Wilson wirklich bemühen, Touristen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten, auf persönliche Weiterempfehlung angewiesen und wir versprechen sehr gerne, dass wir die wirklich erlebenswerte Tour wenigstens in unserer „Overlander“-Community publik machen werden.
Einwohner oft nur nur eine einzige Stunde Wasser pro Tag. Unsere Führung ist damit beendet und wir bedanken uns bei Wilson und unserem Fahrer natürlich mit einem guten Trinkgeld. Auch hier hören wir wieder, dass es so wichtig für die Region und die Menschen wäre, wenn mehr Touristen ins Land kämen, dass es aber von der Regierung hierzu keinerlei Aktivitäten gäbe. So sind die Menschen, die sich wie Wilson wirklich bemühen, Touristen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten, auf persönliche Weiterempfehlung angewiesen und wir versprechen sehr gerne, dass wir die wirklich erlebenswerte Tour wenigstens in unserer „Overlander“-Community publik machen werden.
Von der Salzpfanne zu den Lagunen oder „Das Beste kommt eben meistens zum Schluss“
Für uns geht es am nächsten Tag weiter durch die wilde und karge Berglandschaft Boliviens bis am Horizont vor uns eine unendlich erscheinende, weiße  Fläche auftaucht, was uns sagt, dass wir den „Salar de Uyuni“ erreicht haben. Der Ort „Uyuni“ selbst stellt sich dann als einer der absolut unattraktivsten heraus, den wir auf unserer ganzen Reise besucht haben.
Fläche auftaucht, was uns sagt, dass wir den „Salar de Uyuni“ erreicht haben. Der Ort „Uyuni“ selbst stellt sich dann als einer der absolut unattraktivsten heraus, den wir auf unserer ganzen Reise besucht haben. Staubige Straßen mit einheitlich braunen Häusern, alle Einwohner scheinen hier nur von der Anziehungskraft zu leben, die der „Salar“, als wohl einzige wirklich bekannte Touristenattraktion Boliviens, ausstrahlt. Wir halten uns dann auch nicht lange im Zentrum auf und suchen uns einen Übernachtungsplatz etwas außerhalb, direkt an einem alten Eisenbahnfriedhof. Unzählige Lokomotiven und Waggons, die noch aus der Zeit stammen als das Salz von hier in alle Richtungen per Bahn abtransportiert wurde, rotten hier vor sich hin, bzw. rottet nur noch das vor sich hin was nicht inzwischen gestohlen wurde und dazu zählt einfach alles was an den Zuggarnituren nicht
Staubige Straßen mit einheitlich braunen Häusern, alle Einwohner scheinen hier nur von der Anziehungskraft zu leben, die der „Salar“, als wohl einzige wirklich bekannte Touristenattraktion Boliviens, ausstrahlt. Wir halten uns dann auch nicht lange im Zentrum auf und suchen uns einen Übernachtungsplatz etwas außerhalb, direkt an einem alten Eisenbahnfriedhof. Unzählige Lokomotiven und Waggons, die noch aus der Zeit stammen als das Salz von hier in alle Richtungen per Bahn abtransportiert wurde, rotten hier vor sich hin, bzw. rottet nur noch das vor sich hin was nicht inzwischen gestohlen wurde und dazu zählt einfach alles was an den Zuggarnituren nicht  niet- und nagelfest war. Aber als Kulisse machen sich die alten Züge immer noch gut und es gibt einen riesigen Parkplatz, auf dem man kostenlos übernachten kann. Am späten Vormittag kommen zwar unzählige Touristenjeeps, zu deren Programm eine Besichtigung des Zugfriedhofs zählt, aber
niet- und nagelfest war. Aber als Kulisse machen sich die alten Züge immer noch gut und es gibt einen riesigen Parkplatz, auf dem man kostenlos übernachten kann. Am späten Vormittag kommen zwar unzählige Touristenjeeps, zu deren Programm eine Besichtigung des Zugfriedhofs zählt, aber  ab dem Nachmittag und am Abend, nachdem die Dame nebenan ihr Toilettenhäuschen mit Plumpsklo
ab dem Nachmittag und am Abend, nachdem die Dame nebenan ihr Toilettenhäuschen mit Plumpsklo abgeschlossen hat, herrscht hier
abgeschlossen hat, herrscht hier  absolute Ruhe und wenn der Sonnenuntergang die Waggons dann in orangefarbenes Licht
absolute Ruhe und wenn der Sonnenuntergang die Waggons dann in orangefarbenes Licht  taucht und der Wüstenwind durch sie hindurchpfeift, hat die Kulisse etwas aus einem alten Westernfilm. Wir wollen kochen, doch plötzlich lässt sich der Schlüssel nicht mehr in das Vorhängeschloss stecken mit dem unsere Außenküche gesichert ist. Karl vermutet Klebstoff, wahrscheinlich hat sich jemand während unserem Aufenthalt in „Potosí“, wo wir ein paar Tage entlang der Straße und in der Nähe einer Schule geparkt haben, einen Spaß erlaubt! Also bleibt die Küche kalt und wir fahren am nächsten Tag zurück ins Zentrum von „Uyuni“, wo
taucht und der Wüstenwind durch sie hindurchpfeift, hat die Kulisse etwas aus einem alten Westernfilm. Wir wollen kochen, doch plötzlich lässt sich der Schlüssel nicht mehr in das Vorhängeschloss stecken mit dem unsere Außenküche gesichert ist. Karl vermutet Klebstoff, wahrscheinlich hat sich jemand während unserem Aufenthalt in „Potosí“, wo wir ein paar Tage entlang der Straße und in der Nähe einer Schule geparkt haben, einen Spaß erlaubt! Also bleibt die Küche kalt und wir fahren am nächsten Tag zurück ins Zentrum von „Uyuni“, wo  wir zufällig an einem Arbeiter vorbeikommen, der gerade mit einer Flex neben der Straße arbeitet und der uns netterweise das Schloss gleich aufschneidet. In einer der zahlreichen „Ferreterias“, kleinen Baumärkten, kauft Karl anschließend ein neues, welches zwar jetzt nicht mehr unser „Schlüssel für alles“ sperrt – aber was soll’s. Zufällig
wir zufällig an einem Arbeiter vorbeikommen, der gerade mit einer Flex neben der Straße arbeitet und der uns netterweise das Schloss gleich aufschneidet. In einer der zahlreichen „Ferreterias“, kleinen Baumärkten, kauft Karl anschließend ein neues, welches zwar jetzt nicht mehr unser „Schlüssel für alles“ sperrt – aber was soll’s. Zufällig  kommen wir dabei auch an einer Tankstelle mit einer langen Schlange LKWs vorbei und versuchen dort spontan wieder einmal unser Glück weil wir noch Diesel für die Fahrt bis nach Chile brauchen.
kommen wir dabei auch an einer Tankstelle mit einer langen Schlange LKWs vorbei und versuchen dort spontan wieder einmal unser Glück weil wir noch Diesel für die Fahrt bis nach Chile brauchen.  Wie immer fährt Karl unter den Argusaugen der wartenden LKW-Fahrer bis fast zur Tanksäule vor und diesmal haben wir echtes Glück. Der anwesende Tankwart stellt kurzerhand einen seiner orangenen Absperrkegel dem nächsten wartenden LKW-Fahrer vor die Nase, der das gelassener als gedacht zur Kenntnis nimmt und winkt uns dann von der verkehrten Seite her in die Tankstelle. Zwei soeben tankende LKWs benützt er als Sichtschutz gegen die Kameras und füllt uns beide Tanks randvoll, zwar für umgerechnet 0,80 Euro pro Liter und natürlich „cash und ohne Rechnung“, aber das ist uns herzlich egal, denn jetzt haben wir inkl. unserer Reservekanister auf jeden Fall mehr als genug Diesel um über die „Lagunenroute“ bis nach Chile zu kommen und damit eine Sorge weniger.
Wie immer fährt Karl unter den Argusaugen der wartenden LKW-Fahrer bis fast zur Tanksäule vor und diesmal haben wir echtes Glück. Der anwesende Tankwart stellt kurzerhand einen seiner orangenen Absperrkegel dem nächsten wartenden LKW-Fahrer vor die Nase, der das gelassener als gedacht zur Kenntnis nimmt und winkt uns dann von der verkehrten Seite her in die Tankstelle. Zwei soeben tankende LKWs benützt er als Sichtschutz gegen die Kameras und füllt uns beide Tanks randvoll, zwar für umgerechnet 0,80 Euro pro Liter und natürlich „cash und ohne Rechnung“, aber das ist uns herzlich egal, denn jetzt haben wir inkl. unserer Reservekanister auf jeden Fall mehr als genug Diesel um über die „Lagunenroute“ bis nach Chile zu kommen und damit eine Sorge weniger.
Bezüglich des Befahrens des Salzsees „Salar de Uyuni“, was ja auch ganz privat mit dem eigenen Auto erfolgen kann,  scheiden sich absolut die Geister in der Overlanderszene. Die einen sagen, es geht nichts über eine Fahrt und eine Nacht auf dieser unendlichen, weißen Salzfläche, die anderen und zu denen zählen absolut auch wir, sind der Meinung, auch dieses sicherlich tolle Erlebnis ist es keinesfalls wert, dass man dabei sein
scheiden sich absolut die Geister in der Overlanderszene. Die einen sagen, es geht nichts über eine Fahrt und eine Nacht auf dieser unendlichen, weißen Salzfläche, die anderen und zu denen zählen absolut auch wir, sind der Meinung, auch dieses sicherlich tolle Erlebnis ist es keinesfalls wert, dass man dabei sein Fahrzeug einer Fahrt durch das Salz aussetzt, wobei die Oberfläche des Sees teilweise und je nach Jahreszeit ja auch noch mit einer mehr oder weniger hohen Wasserschicht überzogen ist, wodurch das Salz noch besser und auch noch in die allerletzten Ritzen eines jeden Fahrzeuges verteilt wird. Selbst die „Rallye Dakar“, die den „Salar“ drei Jahre lang im Programm hatte, machte rasch wieder einen großen Bogen darum, da unter anderem die Schäden, vor allem an der Elektronik der Motorräder, einfach riesig waren. Auch dass es in der Umgebung jede Menge Waschanlagen gibt, die versprechen, das Salz im Anschluss wieder von den Fahrzeugen zu entfernen, dabei oft aber durch die Verwendung von viel zu hohem Wasserdruck auch viel kaputt machen, stimmt uns ganz sicher nicht um und so buche ich für uns eine Tagestour im Jeep hinaus auf die riesige Salzfläche. Da ich aber schon bei den Touristenfahrzeugen die an unserem Übernachtungsplatz vorbeikommen gesehen habe, wie vollgepfercht mit Gästen die hier standardmäßig verwendeten Toyota-Landcruiser bei den normalen Touren werden und wir schon gar nicht mit anderen Fahrzeugen im Konvoi fahren wollen, greifen wir mal wieder etwas tiefer in die Tasche und ich buche für uns eine
Fahrzeug einer Fahrt durch das Salz aussetzt, wobei die Oberfläche des Sees teilweise und je nach Jahreszeit ja auch noch mit einer mehr oder weniger hohen Wasserschicht überzogen ist, wodurch das Salz noch besser und auch noch in die allerletzten Ritzen eines jeden Fahrzeuges verteilt wird. Selbst die „Rallye Dakar“, die den „Salar“ drei Jahre lang im Programm hatte, machte rasch wieder einen großen Bogen darum, da unter anderem die Schäden, vor allem an der Elektronik der Motorräder, einfach riesig waren. Auch dass es in der Umgebung jede Menge Waschanlagen gibt, die versprechen, das Salz im Anschluss wieder von den Fahrzeugen zu entfernen, dabei oft aber durch die Verwendung von viel zu hohem Wasserdruck auch viel kaputt machen, stimmt uns ganz sicher nicht um und so buche ich für uns eine Tagestour im Jeep hinaus auf die riesige Salzfläche. Da ich aber schon bei den Touristenfahrzeugen die an unserem Übernachtungsplatz vorbeikommen gesehen habe, wie vollgepfercht mit Gästen die hier standardmäßig verwendeten Toyota-Landcruiser bei den normalen Touren werden und wir schon gar nicht mit anderen Fahrzeugen im Konvoi fahren wollen, greifen wir mal wieder etwas tiefer in die Tasche und ich buche für uns eine  private Tour nur für uns zwei plus Chauffeur und Reiseleiter. Um 10.00 Uhr Vormittag geht’s los, unser Guide Aryel und der Fahrer Marco kommen uns am Zugfriedhof abholen und bieten uns dann den ganzen Tag lang einen Service den man wohl nicht oft findet. Die Tour führt als erstes nach „Colchani“, wo die Einheimischen sich zu einer Vermarktung des Salzes, das nicht zu Speisesalz
private Tour nur für uns zwei plus Chauffeur und Reiseleiter. Um 10.00 Uhr Vormittag geht’s los, unser Guide Aryel und der Fahrer Marco kommen uns am Zugfriedhof abholen und bieten uns dann den ganzen Tag lang einen Service den man wohl nicht oft findet. Die Tour führt als erstes nach „Colchani“, wo die Einheimischen sich zu einer Vermarktung des Salzes, das nicht zu Speisesalz  verarbeitet wird, zusammengeschlossen haben. In Säcken holen sie das Salz mit Pickups von weit draußen aus dem „Salar“und fertigen daraus unglaublich fein gearbeitete Figuren, kunstvoll verpacktes Badesalz und viele andere Souvenirs, die sie anschließend an die Touristen verkaufen. Irgendeine Regierung hatte ihnen vor Jahren ungefragt nebenan eine Fabrik hingebaut, um die Herstellung dorthin zu verlagern. Die Einheimischen weigerten sich jedoch von ihrem Handwerk abzuweichen und die Fabrik wurde niemals eröffnet und
verarbeitet wird, zusammengeschlossen haben. In Säcken holen sie das Salz mit Pickups von weit draußen aus dem „Salar“und fertigen daraus unglaublich fein gearbeitete Figuren, kunstvoll verpacktes Badesalz und viele andere Souvenirs, die sie anschließend an die Touristen verkaufen. Irgendeine Regierung hatte ihnen vor Jahren ungefragt nebenan eine Fabrik hingebaut, um die Herstellung dorthin zu verlagern. Die Einheimischen weigerten sich jedoch von ihrem Handwerk abzuweichen und die Fabrik wurde niemals eröffnet und  rostet jetzt vor sich hin – Das ist typisch für die verkehrte Welt von Bolivien! Natürlich kaufen wir gerne ein paar Souvenirs und dann geht es weiter zum „Palacio de Sal“, einem Hotel das nahezu zur Gänze aus Salz erbaut wurde. Wir dürfen das luxuriöse Haus besichtigen, das eine sehr spezielle Atmosphäre ausstrahlt. Besonders die
rostet jetzt vor sich hin – Das ist typisch für die verkehrte Welt von Bolivien! Natürlich kaufen wir gerne ein paar Souvenirs und dann geht es weiter zum „Palacio de Sal“, einem Hotel das nahezu zur Gänze aus Salz erbaut wurde. Wir dürfen das luxuriöse Haus besichtigen, das eine sehr spezielle Atmosphäre ausstrahlt. Besonders die  Aussicht von der Lobby und vom erst kürzlich neu gebauten Wellnessbereich durch die riesigen Glasflächen hinaus auf die Salzwüste des „Salars“ ist natürlich einzigartig. Die Preise für eine Übernachtung beginne
Aussicht von der Lobby und vom erst kürzlich neu gebauten Wellnessbereich durch die riesigen Glasflächen hinaus auf die Salzwüste des „Salars“ ist natürlich einzigartig. Die Preise für eine Übernachtung beginne n so bei 265 US$ pro Zimmer und Nacht und die Gäste kommen laut unserem Guide wohl tatsächlich aus der ganzen Welt. Wir dürfen uns in der schönen Lobby noch vom Teebüffet bedienen und gerne mache ich dabei noch ein paar Fotos mit zwei netten Damen, die mich darum bitten, weil ihnen, wie sie mir sagen, meine blonden Haare und mein mexikanischer Hut so gut gefallen…! Dann geht unsere Tour wieder weiter und wir fahren hinaus auf die unglaublich riesige, blendend weiße Salzfläche die im Moment eine Fläche von unglaublichen 12.000 km2 einnimmt,
n so bei 265 US$ pro Zimmer und Nacht und die Gäste kommen laut unserem Guide wohl tatsächlich aus der ganzen Welt. Wir dürfen uns in der schönen Lobby noch vom Teebüffet bedienen und gerne mache ich dabei noch ein paar Fotos mit zwei netten Damen, die mich darum bitten, weil ihnen, wie sie mir sagen, meine blonden Haare und mein mexikanischer Hut so gut gefallen…! Dann geht unsere Tour wieder weiter und wir fahren hinaus auf die unglaublich riesige, blendend weiße Salzfläche die im Moment eine Fläche von unglaublichen 12.000 km2 einnimmt,  aber jährlich noch um ca. 1.000 km2 zunimmt. Der „Salar“ wird von Wasser aus den umliegenden Bergen gespeist, ist an seiner tiefsten Stelle über 200 m tief und von einer bis zu 11 m dicken Salzkruste überzogen, die aber nur während der Trockenzeit des südamerikanischen Winters, also von Juni bis November, gefahrlos befahren werden kann.
aber jährlich noch um ca. 1.000 km2 zunimmt. Der „Salar“ wird von Wasser aus den umliegenden Bergen gespeist, ist an seiner tiefsten Stelle über 200 m tief und von einer bis zu 11 m dicken Salzkruste überzogen, die aber nur während der Trockenzeit des südamerikanischen Winters, also von Juni bis November, gefahrlos befahren werden kann. Von Dezember bis Mai ist die Oberfläche mit einer bis zu 30 cm hohen Wasserschicht bedeckt und insbesonders an
Von Dezember bis Mai ist die Oberfläche mit einer bis zu 30 cm hohen Wasserschicht bedeckt und insbesonders an  den Rändern bilden sich dann Löcher, die sich an manchen Stellen das ganze Jahr über nicht schließen und eine große Gefahr für Fahrzeuge darstellen, die ohne Ortskenntnis den „Salar“ befahren, was den zahlreichen Bergungsfirmen in „Uyuni“ immer wieder zu regen Einnahmen verhilft.
den Rändern bilden sich dann Löcher, die sich an manchen Stellen das ganze Jahr über nicht schließen und eine große Gefahr für Fahrzeuge darstellen, die ohne Ortskenntnis den „Salar“ befahren, was den zahlreichen Bergungsfirmen in „Uyuni“ immer wieder zu regen Einnahmen verhilft.  Wir fahren als erstes zum „Playa Blanca“, wo das „Dakar Monument“ als einziges noch an den dreimaligen Besuch der berühmten Rallye in den Jahren 2014-2016 hier erinnert. Gleich daneben wehen bunte Fahnen im Wind, die von Besuchern aus
Wir fahren als erstes zum „Playa Blanca“, wo das „Dakar Monument“ als einziges noch an den dreimaligen Besuch der berühmten Rallye in den Jahren 2014-2016 hier erinnert. Gleich daneben wehen bunte Fahnen im Wind, die von Besuchern aus  der ganzen Welt hier angebracht wurden, schade dass wir keine österreichische Fahne mithaben, denn die fehlt hier leider. Das Ganze gruppiert sich rund um ein kleines, altes Salzhotel, das damals extra für die „Rallye
der ganzen Welt hier angebracht wurden, schade dass wir keine österreichische Fahne mithaben, denn die fehlt hier leider. Das Ganze gruppiert sich rund um ein kleines, altes Salzhotel, das damals extra für die „Rallye  Dakar“ erbaut wurde, als diese genau hier eines ihrer Übernachtungsbiwaks aufschlug. Es wird aber inzwischen nicht mehr viel benützt, man kann Getränke kaufen und in den nur 10 Zimmer, die alle die Namen bolivianischer Städte tragen,
Dakar“ erbaut wurde, als diese genau hier eines ihrer Übernachtungsbiwaks aufschlug. Es wird aber inzwischen nicht mehr viel benützt, man kann Getränke kaufen und in den nur 10 Zimmer, die alle die Namen bolivianischer Städte tragen,  übernachten höchstens ab und zu ein paar Radfahrer, die den „Salar“ überqueren. Wir brechen wieder auf und fahren noch weiter hinaus auf die Salzfläche und zwar so weit, bis rings um uns wirklich nichts anderes mehr zu sehen ist, als die weißen Sechsecke der Salzkruste und darüber der dunkelblaue bolivianische Himmel. Hier halten
übernachten höchstens ab und zu ein paar Radfahrer, die den „Salar“ überqueren. Wir brechen wieder auf und fahren noch weiter hinaus auf die Salzfläche und zwar so weit, bis rings um uns wirklich nichts anderes mehr zu sehen ist, als die weißen Sechsecke der Salzkruste und darüber der dunkelblaue bolivianische Himmel. Hier halten wir an und während wir fasziniert dieses unglaubliche Panorama in uns aufnehmen und über die knirschende Salzfläche spazieren, bauen unsere beiden Begleiter unser Mittagessen auf. Ein Tisch, zwei Stühle und ein Sonnenschirm werden
wir an und während wir fasziniert dieses unglaubliche Panorama in uns aufnehmen und über die knirschende Salzfläche spazieren, bauen unsere beiden Begleiter unser Mittagessen auf. Ein Tisch, zwei Stühle und ein Sonnenschirm werden mitten in die Einsamkeit gestellt und darauf die mitgebrachten Speisen liebevoll angerichtet. Es gibt typisch bolivianisches „Aphtapi“, eine Tradition die ursprünglich aus den Andendörfern stammt
mitten in die Einsamkeit gestellt und darauf die mitgebrachten Speisen liebevoll angerichtet. Es gibt typisch bolivianisches „Aphtapi“, eine Tradition die ursprünglich aus den Andendörfern stammt  und die verschiedene Speisen umfasst, die von Familie, Verwandten oder Freunden mitgebracht werden, die sich zu einem gemeinsamen Essen treffen. In unserem Fall enthält es diverse, gebratene Fleischsorten, Gemüse, eine Art Polenta, wunderbares ganz fein geschnittenes und gesalzenes Trockenfleisch und zwei Sorten von Käse. Alles schmeckt fantastisch und natürlich laden wir unsere Crew ein, sich zu
und die verschiedene Speisen umfasst, die von Familie, Verwandten oder Freunden mitgebracht werden, die sich zu einem gemeinsamen Essen treffen. In unserem Fall enthält es diverse, gebratene Fleischsorten, Gemüse, eine Art Polenta, wunderbares ganz fein geschnittenes und gesalzenes Trockenfleisch und zwei Sorten von Käse. Alles schmeckt fantastisch und natürlich laden wir unsere Crew ein, sich zu uns zu setzen, was die beiden, nach anfänglichem Zögern, gerne annehmen und wir verbringen somit ein geselliges Mittagessen vor der einzigartigen Kulisse des „Salars“. Bei dieser Gelegenheit erhalten wir von Aryel, der sehr gut englisch spricht, auch noch viele andere Informationen über Bolivien. So klärt er uns auch über die nach
uns zu setzen, was die beiden, nach anfänglichem Zögern, gerne annehmen und wir verbringen somit ein geselliges Mittagessen vor der einzigartigen Kulisse des „Salars“. Bei dieser Gelegenheit erhalten wir von Aryel, der sehr gut englisch spricht, auch noch viele andere Informationen über Bolivien. So klärt er uns auch über die nach  wie vor schwelende Feindschaft zwischen Bolivien und Chile auf, die wir bereits immer wieder aus diversen Gesprächen und Bemerkungen von Menschen hier im Land herausgehört haben. Er erzählt uns, dass die Bolivianer den Chilenen nie verziehen haben, dass sie im Anschluss an den 1883 verlorenen „Salpeterkrieg“ 120.000 Quadratkilometer Land und, was noch viel schwerer wog, die gesamten 400 km Küste an sie abgeben mussten, was Bolivien, neben Paraguay, zum zweiten südamerikanischen Binnenland machte und natürlich bis heute mit riesigen, wirtschaftlichen Nachteilen verbunden ist. Seither hat Bolivien vielfach versucht, Chile zu bewegen, ihnen wieder einen Zugang zum Pazifik zu gewähren, die Chilenen haben es aber stets abgelehnt auch nur darüber zu verhandeln. Selbst der internationale Gerichtshof den Bolivien dazu 2013 angerufen hat, hat dazu festgestellt, dass Chile das Recht hat diese Verhandlungen abzulehnen, was natürlich den Groll der Bolivianer auf ihre Nachbarn noch verstärkt hat. Diese interessante Unterhaltung und natürlich die so einzigartige Kulisse des „Salars“ machen dieses Mittagessen zu etwas ganz Besonderem. Im Anschluss schießt Aryel, auf dem Bauch liegend, noch ein paar witzige Fotos von uns, die
wie vor schwelende Feindschaft zwischen Bolivien und Chile auf, die wir bereits immer wieder aus diversen Gesprächen und Bemerkungen von Menschen hier im Land herausgehört haben. Er erzählt uns, dass die Bolivianer den Chilenen nie verziehen haben, dass sie im Anschluss an den 1883 verlorenen „Salpeterkrieg“ 120.000 Quadratkilometer Land und, was noch viel schwerer wog, die gesamten 400 km Küste an sie abgeben mussten, was Bolivien, neben Paraguay, zum zweiten südamerikanischen Binnenland machte und natürlich bis heute mit riesigen, wirtschaftlichen Nachteilen verbunden ist. Seither hat Bolivien vielfach versucht, Chile zu bewegen, ihnen wieder einen Zugang zum Pazifik zu gewähren, die Chilenen haben es aber stets abgelehnt auch nur darüber zu verhandeln. Selbst der internationale Gerichtshof den Bolivien dazu 2013 angerufen hat, hat dazu festgestellt, dass Chile das Recht hat diese Verhandlungen abzulehnen, was natürlich den Groll der Bolivianer auf ihre Nachbarn noch verstärkt hat. Diese interessante Unterhaltung und natürlich die so einzigartige Kulisse des „Salars“ machen dieses Mittagessen zu etwas ganz Besonderem. Im Anschluss schießt Aryel, auf dem Bauch liegend, noch ein paar witzige Fotos von uns, die  auf der endlosen Salzfläche natürlich ganz eigene Effekte erzielen und deren Ergebnis uns jede Menge Spaß bereitet. Dadurch dass wir sozusagen „ganz privat“ unterwegs sind, kann unser Guide es auch so einrichten, dass wir immer zu der Zeit an
auf der endlosen Salzfläche natürlich ganz eigene Effekte erzielen und deren Ergebnis uns jede Menge Spaß bereitet. Dadurch dass wir sozusagen „ganz privat“ unterwegs sind, kann unser Guide es auch so einrichten, dass wir immer zu der Zeit an  den sehenswerten Plätzen sind, wenn aus seiner Erfahrung nicht viele andere Besucher gleichzeitig dort sind. Er kennt natürlich die Zeiten der unzähligen Jeeptouren die hier auf dem „Salar“ unterwegs sind und hält uns aus den Stoßzeiten heraus, sodass uns immer das Gefühl der
den sehenswerten Plätzen sind, wenn aus seiner Erfahrung nicht viele andere Besucher gleichzeitig dort sind. Er kennt natürlich die Zeiten der unzähligen Jeeptouren die hier auf dem „Salar“ unterwegs sind und hält uns aus den Stoßzeiten heraus, sodass uns immer das Gefühl der  ganz privaten Tour erhalten bleibt. Als nächstes Ziel erreichen wir nach einer Fahrt von ca. einer halben Stunde eine der 33 aus der Salzfläche aufragenden Inseln, nämlich „Incahuasi“, auf der wir bis zum „Gipfel“ hinaufsteigen und dabei die riesigen hier wachsenden Kakteen genauso bewundern wie die unzähligen in den Felsen eingeschlossenen Korallen, die davon zeugen, dass sich die Insel ursprünglich einmal unter Wasser befunden hat. Oben angekommen, bietet sich uns ein unglaublicher 360° Rundumblick über den „Salar“ der einem schlicht den Atem raubt. Die durch die Salzwüste fahrenden Fahrzeuge, die man in der
ganz privaten Tour erhalten bleibt. Als nächstes Ziel erreichen wir nach einer Fahrt von ca. einer halben Stunde eine der 33 aus der Salzfläche aufragenden Inseln, nämlich „Incahuasi“, auf der wir bis zum „Gipfel“ hinaufsteigen und dabei die riesigen hier wachsenden Kakteen genauso bewundern wie die unzähligen in den Felsen eingeschlossenen Korallen, die davon zeugen, dass sich die Insel ursprünglich einmal unter Wasser befunden hat. Oben angekommen, bietet sich uns ein unglaublicher 360° Rundumblick über den „Salar“ der einem schlicht den Atem raubt. Die durch die Salzwüste fahrenden Fahrzeuge, die man in der  Ferne sehen kann, wirken wie Spielzeugautos und die Szenerie ist einfach grandios. Niemand außer uns befindet sich in diesem Moment hier oben und es ist ein wirklich spezieller Augenblick. Danach geht es weiter zu dem Platz auf den ich mich besonders freue, ein sehr bekannter
Ferne sehen kann, wirken wie Spielzeugautos und die Szenerie ist einfach grandios. Niemand außer uns befindet sich in diesem Moment hier oben und es ist ein wirklich spezieller Augenblick. Danach geht es weiter zu dem Platz auf den ich mich besonders freue, ein sehr bekannter  Künstler aus der Region hat vor vielen Jahren mitten auf dem „Salar“ den „Stairway to heaven“ eine völlig freistehende Treppe aus Salz erbaut, die, wenn man in richtiger Position davorsteht, wirklich aussieht, als führe sie direkt hinauf in den Himmel. Wir haben wettermäßig einen echten Traumtag erwischt und können auch hier wieder wunderschöne Fotos machen. In der Nähe der berühmten Treppe haben sich
Künstler aus der Region hat vor vielen Jahren mitten auf dem „Salar“ den „Stairway to heaven“ eine völlig freistehende Treppe aus Salz erbaut, die, wenn man in richtiger Position davorsteht, wirklich aussieht, als führe sie direkt hinauf in den Himmel. Wir haben wettermäßig einen echten Traumtag erwischt und können auch hier wieder wunderschöne Fotos machen. In der Nähe der berühmten Treppe haben sich einige Künstler aus dem Salzort „Colchani“ zusammengetan und bauen dort im Moment noch andere Salzfiguren.
einige Künstler aus dem Salzort „Colchani“ zusammengetan und bauen dort im Moment noch andere Salzfiguren.  Besonders beeindruckend finden wir hier die „Hand Gottes“ und die „Pachamama“. Gerade als wir dort sind bauen sie schon wieder an einer neuen Figur. Es ist eine lustige Runde die hier am Werk ist, sie zeigen uns, wie sie die zum Bau benötigten Salzziegel ganz in der Nähe einfach aus dem Boden schneiden, dann laden sie uns sogar noch zu einem Bier ein,
Besonders beeindruckend finden wir hier die „Hand Gottes“ und die „Pachamama“. Gerade als wir dort sind bauen sie schon wieder an einer neuen Figur. Es ist eine lustige Runde die hier am Werk ist, sie zeigen uns, wie sie die zum Bau benötigten Salzziegel ganz in der Nähe einfach aus dem Boden schneiden, dann laden sie uns sogar noch zu einem Bier ein,  Künstler sind, wie überall auf der Welt, eben auch hier immer durstig und wir beobachten sie eine Zeit lang bei ihrer Arbeit. Der wunderbare Tag auf dem
Künstler sind, wie überall auf der Welt, eben auch hier immer durstig und wir beobachten sie eine Zeit lang bei ihrer Arbeit. Der wunderbare Tag auf dem „Salar de Uyuni“ neigt sich inzwischen langsam dem Ende zu und zum Abschluss zeigen uns unsere beiden Begleiter noch ein paar der gefürchteten „Ojos“, das sind die Löcher in der Salzkruste, die wirklich gefährlich
„Salar de Uyuni“ neigt sich inzwischen langsam dem Ende zu und zum Abschluss zeigen uns unsere beiden Begleiter noch ein paar der gefürchteten „Ojos“, das sind die Löcher in der Salzkruste, die wirklich gefährlich für Fahrzeuge sind, wenn man ihre Lage nicht kennt. Als die Sonne zu sinken beginnt, wird in der absoluten
für Fahrzeuge sind, wenn man ihre Lage nicht kennt. Als die Sonne zu sinken beginnt, wird in der absoluten Einsamkeit noch einmal ein Tisch für uns aufgebaut, der liebevoll dekoriert und mit Käse, Chips, Oliven und einer wunderbaren Flasche bolivianischen Rotweins
Einsamkeit noch einmal ein Tisch für uns aufgebaut, der liebevoll dekoriert und mit Käse, Chips, Oliven und einer wunderbaren Flasche bolivianischen Rotweins gedeckt wird. Diesmal lässt sich unsere Crew nicht umstimmen und hält sich respektvoll im Hintergrund und wir genießen zu zweit einen der speziellsten und stimmungsvollsten Sonnenuntergänge unserer Reise. Erst als die Flasche leer ist und die Dunkelheit hereinbricht,
gedeckt wird. Diesmal lässt sich unsere Crew nicht umstimmen und hält sich respektvoll im Hintergrund und wir genießen zu zweit einen der speziellsten und stimmungsvollsten Sonnenuntergänge unserer Reise. Erst als die Flasche leer ist und die Dunkelheit hereinbricht, treten wir die Rückfahrt zum Unimog an. Keiner der beiden Guides hat auf die Uhr geschaut und dass wir die vereinbarte Zeit für den Ausflug weit überzogen haben, scheint hier niemanden zu stören. Als wir uns am Schluss von Aryel und Marco verabschieden, sind wir sicher, dass dieser Tag auf dem „Salar de Uyuni“ eines der schönsten Tourerlebnisse war, das wir auf unserer Reise erlebt haben und das wir wirklich ohne Einschränkungen jederzeit weiterempfehlen können. Unser Unimog blieb vom Salz verschont und wir hatten wirklich einen Traumtag!
treten wir die Rückfahrt zum Unimog an. Keiner der beiden Guides hat auf die Uhr geschaut und dass wir die vereinbarte Zeit für den Ausflug weit überzogen haben, scheint hier niemanden zu stören. Als wir uns am Schluss von Aryel und Marco verabschieden, sind wir sicher, dass dieser Tag auf dem „Salar de Uyuni“ eines der schönsten Tourerlebnisse war, das wir auf unserer Reise erlebt haben und das wir wirklich ohne Einschränkungen jederzeit weiterempfehlen können. Unser Unimog blieb vom Salz verschont und wir hatten wirklich einen Traumtag!
Dank unseres Tankerfolges in „Uyuni“ können wir nun auch noch die letzte Strecke durch Bolivien angehen und es ist ein Abschnitt auf den ich mich  besonders freue, nämlich die „Lagunenroute“, die über das bolivianische „Altiplano“, also der Hochebene zwischen den Hochgebirgsketten der Westanden und der Ostanden, bis nach „San Pedro de Atacama“ in Chile führt. Es gibt hierbei nicht die „eine“ Lagunenroute, sondern viele verschiedene Varianten und je nach dem welche davon man wählt und wieviele Lagunen man dann wirklich anfährt, liegt die Länge der Strecke, auf der man sich größtenteils auf einer Höhe zwischen 4.000 und 5.000 m bewegt, bei 400 bis 500 km. Tankmöglichkeit gibt es dabei größtenteils
besonders freue, nämlich die „Lagunenroute“, die über das bolivianische „Altiplano“, also der Hochebene zwischen den Hochgebirgsketten der Westanden und der Ostanden, bis nach „San Pedro de Atacama“ in Chile führt. Es gibt hierbei nicht die „eine“ Lagunenroute, sondern viele verschiedene Varianten und je nach dem welche davon man wählt und wieviele Lagunen man dann wirklich anfährt, liegt die Länge der Strecke, auf der man sich größtenteils auf einer Höhe zwischen 4.000 und 5.000 m bewegt, bei 400 bis 500 km. Tankmöglichkeit gibt es dabei größtenteils  keine, auch mit Wasser und Lebensmitteln sollte man sich bereits vor der Abfahrt versorgen, was wir in „Uyuni“ noch erledigen und uns dann auf den Weg machen. Bezüglich der Befahrung der „Lagunenroute“ haben wir von Overlandern wieder einmal die unterschiedlichsten Meinungen gehört. Einige sagen, die Strecke lässt sich
keine, auch mit Wasser und Lebensmitteln sollte man sich bereits vor der Abfahrt versorgen, was wir in „Uyuni“ noch erledigen und uns dann auf den Weg machen. Bezüglich der Befahrung der „Lagunenroute“ haben wir von Overlandern wieder einmal die unterschiedlichsten Meinungen gehört. Einige sagen, die Strecke lässt sich ohne weiteres auch mit einem Camper ohne Allrad befahren, andere haben mit großen Allrad-Trucks nach kurzer Zeit umgedreht mit der Bemerkung „Ich mach‘ mir doch hier nicht mein Fahrzeug kaputt…“. Also wissen wir nicht wirklich genau was auf uns zukommt, aber Karl hat wie immer alles notwendige am Auto gecheckt und wir
ohne weiteres auch mit einem Camper ohne Allrad befahren, andere haben mit großen Allrad-Trucks nach kurzer Zeit umgedreht mit der Bemerkung „Ich mach‘ mir doch hier nicht mein Fahrzeug kaputt…“. Also wissen wir nicht wirklich genau was auf uns zukommt, aber Karl hat wie immer alles notwendige am Auto gecheckt und wir  haben mit Sicherheit inzwischen genug Vertrauen in unserem Unimog, dass wir uns sorgenfrei auf die Strecke begeben. Nach den ersten Kilometern, die sich noch auf Asphalt abspielen, biegen wir ein in die eigentliche Piste und sofort reduziert sich unsere Geschwindigkeit bedeutend, denn die Strecke präsentiert sich uns von Anfang an als unerbittliches „Waschbrett“ und jetzt weiß ich auch, warum das Navi hier für 22 Kilometer 1 Stunde und 20 Minuten anzeigt. Nachstehend werde ich jetzt nur die absoluten highlights aus den Tagen dieser wirklich atemberaubenden Tour beschreiben, alles andere würde sogar für mich den Rahmen hier sprengen. Vorbei am „Valle de las Rocas“ mit seinen
haben mit Sicherheit inzwischen genug Vertrauen in unserem Unimog, dass wir uns sorgenfrei auf die Strecke begeben. Nach den ersten Kilometern, die sich noch auf Asphalt abspielen, biegen wir ein in die eigentliche Piste und sofort reduziert sich unsere Geschwindigkeit bedeutend, denn die Strecke präsentiert sich uns von Anfang an als unerbittliches „Waschbrett“ und jetzt weiß ich auch, warum das Navi hier für 22 Kilometer 1 Stunde und 20 Minuten anzeigt. Nachstehend werde ich jetzt nur die absoluten highlights aus den Tagen dieser wirklich atemberaubenden Tour beschreiben, alles andere würde sogar für mich den Rahmen hier sprengen. Vorbei am „Valle de las Rocas“ mit seinen  gezackten Felsformationen führt uns die Strecke von Beginn an durch eine faszinierende Landschaft und als wir gegen Ende des ersten Tages einen einsamen Übernachtungsplatz suchen, finden wir genau
gezackten Felsformationen führt uns die Strecke von Beginn an durch eine faszinierende Landschaft und als wir gegen Ende des ersten Tages einen einsamen Übernachtungsplatz suchen, finden wir genau  das was wir suchen an der „Laguna Vinto“. Die Sonne geht gerade farbenprächtig unter, wir
das was wir suchen an der „Laguna Vinto“. Die Sonne geht gerade farbenprächtig unter, wir  erhaschen noch einen letzten Blick auf eine große Gruppe Flamingos in der Lagune, doch der pfeifende, eiskalte Wind verbannt uns bald ins Innere des Unimogs.
erhaschen noch einen letzten Blick auf eine große Gruppe Flamingos in der Lagune, doch der pfeifende, eiskalte Wind verbannt uns bald ins Innere des Unimogs. Als am nächste Tag um 06.00 Uhr früh die Sonne wieder aufgeht, wecken mich verdächtige Geräusche von draußen und als ich einen Blick aus dem Fenster werfe, kann ich gar nicht glauben was ich da sehe. Eine riesige Herde Lamas hat sich rund um den Unimog verteilt und die Tiere trinken nacheinander aus dem kleinen Bach neben dem wir stehen. Es
Als am nächste Tag um 06.00 Uhr früh die Sonne wieder aufgeht, wecken mich verdächtige Geräusche von draußen und als ich einen Blick aus dem Fenster werfe, kann ich gar nicht glauben was ich da sehe. Eine riesige Herde Lamas hat sich rund um den Unimog verteilt und die Tiere trinken nacheinander aus dem kleinen Bach neben dem wir stehen. Es  herrscht völlige Stille, selbst der Wind hat sich über
herrscht völlige Stille, selbst der Wind hat sich über  Nacht gelegt und ich beobachte über zwei Stunden lang die Lamas ringsherum und die ebenfalls
Nacht gelegt und ich beobachte über zwei Stunden lang die Lamas ringsherum und die ebenfalls langsam immer näher herankommenden, rosaroten Flamingos. Ich komme mir vor wie mitten in einem „Universum“-Film und wir genießen dann diese unberührte Landschaft noch den ganzen Vormittag. Auf der Weiterfahrt passieren wir
langsam immer näher herankommenden, rosaroten Flamingos. Ich komme mir vor wie mitten in einem „Universum“-Film und wir genießen dann diese unberührte Landschaft noch den ganzen Vormittag. Auf der Weiterfahrt passieren wir  dann die außergewöhnlichen roten Felsen der „Rocas Volcánicas“, dann tauchen schneebedeckte Gipfel am Horizont auf und ein junges Mädchen kassiert 1 Boliviano (0,13 Euros) Maut, für was auch immer. Wenn sich die Piste
dann die außergewöhnlichen roten Felsen der „Rocas Volcánicas“, dann tauchen schneebedeckte Gipfel am Horizont auf und ein junges Mädchen kassiert 1 Boliviano (0,13 Euros) Maut, für was auch immer. Wenn sich die Piste  vor uns wieder einmal in unendlich viele Spuren nebeneinander teilt, versucht Karl demjenigen Track zu folgen auf dem es am wenigsten holpert und wir haben dabei natürlich den großen Vorteil, dass sich der Unimog unbeirrt seinen Weg auch
vor uns wieder einmal in unendlich viele Spuren nebeneinander teilt, versucht Karl demjenigen Track zu folgen auf dem es am wenigsten holpert und wir haben dabei natürlich den großen Vorteil, dass sich der Unimog unbeirrt seinen Weg auch  durch den Tiefsand sucht. Aber meistens ist auch auf den Ausweichspuren das Waschbrett unbarmherzig und manchmal habe ich den Verdacht, als leide Karl bei jedem Stoß mit – Nicht für sich selbst natürlich, sondern für den Unimog! Ich für mich denke mir da etwas salopper (aber heimlich…) ein Unimog muss das wohl aushalten. Nach ein paar Stunden Fahrt auf der rippigen Piste kommt es dann aber auch mir irgendwann so vor, als würden mir jetzt bald alle Plomben aus den Zähnen fliegen. Noch nie haben wir so eine schlimme Wellblechpiste durchgehend auf einer so langen Strecke erlebt, noch nicht einmal in Westaustralien und da dachten wir schon, dass es extrem wäre. Wir
durch den Tiefsand sucht. Aber meistens ist auch auf den Ausweichspuren das Waschbrett unbarmherzig und manchmal habe ich den Verdacht, als leide Karl bei jedem Stoß mit – Nicht für sich selbst natürlich, sondern für den Unimog! Ich für mich denke mir da etwas salopper (aber heimlich…) ein Unimog muss das wohl aushalten. Nach ein paar Stunden Fahrt auf der rippigen Piste kommt es dann aber auch mir irgendwann so vor, als würden mir jetzt bald alle Plomben aus den Zähnen fliegen. Noch nie haben wir so eine schlimme Wellblechpiste durchgehend auf einer so langen Strecke erlebt, noch nicht einmal in Westaustralien und da dachten wir schon, dass es extrem wäre. Wir  passieren dann die komplett ausgetrocknete „Laguna Capina“, die, wie sie so mit bizarren Felsen umrahmt ist, fast an eine Mondlandschaft erinnert. Hier wird ebenfalls Salz abgebaut und die durch die Salzkristalle blendend weiße Oberfläche glitzert in der Sonne vor dem dunkelblauen Himmel Boliviens. Die Sonne brennt am Tag so
passieren dann die komplett ausgetrocknete „Laguna Capina“, die, wie sie so mit bizarren Felsen umrahmt ist, fast an eine Mondlandschaft erinnert. Hier wird ebenfalls Salz abgebaut und die durch die Salzkristalle blendend weiße Oberfläche glitzert in der Sonne vor dem dunkelblauen Himmel Boliviens. Die Sonne brennt am Tag so  heiß herunter wie noch vor einigen Monaten in Kolumbien und auf dieser Fahrt über die Hochebenen des „Altiplano“ beginnen wir zu verstehen, warum es heißt, dass der Himmel nirgendwo auf der Welt eine so dunkelblaue Farbe hat wie in Bolivien. Wir erreichen den Eingang zum Nationalpark mit dem sperrigen Namen „Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa“, die Schranke ist zu, der Beamte der hier in der Einöde Dienst tut, macht aber keinerlei Anstalten aus seinem 50 m entfernten Wachhaus zu kommen, gibt uns aber auch nicht zu verstehen, dass wir zu ihm kommen sollen. Irgendwann wird es mir zu blöd und ich steige aus und gehe hinüber zu seinem Büro, wo er seelenruhig hinter seinem Schreibtisch sitzt und bereits die beiden Eintrittskarten für uns vorbereitet hat. Er bedenkt mich mit einem Blick der in etwa aussagt: „Na endlich, warum nicht gleich, ihr glaubt wohl nicht wirklich, dass ich zu Euch raus komme…“, ich trage unsere Daten in seine Liste ein und bezahle umgerechnet 40 Euros. Dann muss er letztendlich aber doch noch mit mir vor die Tür gehen um uns die Schranke zu öffnen und
heiß herunter wie noch vor einigen Monaten in Kolumbien und auf dieser Fahrt über die Hochebenen des „Altiplano“ beginnen wir zu verstehen, warum es heißt, dass der Himmel nirgendwo auf der Welt eine so dunkelblaue Farbe hat wie in Bolivien. Wir erreichen den Eingang zum Nationalpark mit dem sperrigen Namen „Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa“, die Schranke ist zu, der Beamte der hier in der Einöde Dienst tut, macht aber keinerlei Anstalten aus seinem 50 m entfernten Wachhaus zu kommen, gibt uns aber auch nicht zu verstehen, dass wir zu ihm kommen sollen. Irgendwann wird es mir zu blöd und ich steige aus und gehe hinüber zu seinem Büro, wo er seelenruhig hinter seinem Schreibtisch sitzt und bereits die beiden Eintrittskarten für uns vorbereitet hat. Er bedenkt mich mit einem Blick der in etwa aussagt: „Na endlich, warum nicht gleich, ihr glaubt wohl nicht wirklich, dass ich zu Euch raus komme…“, ich trage unsere Daten in seine Liste ein und bezahle umgerechnet 40 Euros. Dann muss er letztendlich aber doch noch mit mir vor die Tür gehen um uns die Schranke zu öffnen und  siehe da, er bedenkt uns zum Abschied sogar noch mit einem Lächeln. Wenig später erreichen wir das Schmuckstück des Nationalparks, die in allen möglichen Farben leuchtende „Laguna Colorada“. Wir fahren sie an der Nordseite an, und wollen dann an der Lagune entlang zur Südseite zu fahren, leider ist diese Strecke aber dann, als wir endlich unten am Ufer ankommen, mit Steinen und einer Tafel blockiert, die uns darüber informiert, dass diese Strecke aufgrund von Aktivitäten irgendwelcher Vögel gesperrt ist. Ich rege mich wieder einmal kurz darüber auf, warum man so eine Tafel nicht ganz oben an der Hauptroute aufstellen kann, denn, um jetzt die ganze Strecke wieder zurück und dann mit großem Umweg direkt von Süden her an die Lagune heranzufahren, fehlt uns bis zum Einbruch der Dunkelheit die Zeit und ganz ehrlich auch die Lust. Wir suchen uns daher hier auf der Nordseite einen erhöhten Platz mit schöner Sicht über die Lagune, pfeifen auf sämtliche
siehe da, er bedenkt uns zum Abschied sogar noch mit einem Lächeln. Wenig später erreichen wir das Schmuckstück des Nationalparks, die in allen möglichen Farben leuchtende „Laguna Colorada“. Wir fahren sie an der Nordseite an, und wollen dann an der Lagune entlang zur Südseite zu fahren, leider ist diese Strecke aber dann, als wir endlich unten am Ufer ankommen, mit Steinen und einer Tafel blockiert, die uns darüber informiert, dass diese Strecke aufgrund von Aktivitäten irgendwelcher Vögel gesperrt ist. Ich rege mich wieder einmal kurz darüber auf, warum man so eine Tafel nicht ganz oben an der Hauptroute aufstellen kann, denn, um jetzt die ganze Strecke wieder zurück und dann mit großem Umweg direkt von Süden her an die Lagune heranzufahren, fehlt uns bis zum Einbruch der Dunkelheit die Zeit und ganz ehrlich auch die Lust. Wir suchen uns daher hier auf der Nordseite einen erhöhten Platz mit schöner Sicht über die Lagune, pfeifen auf sämtliche  Vorschriften, dass man im Nationalpark nicht einfach irgendwo campen darf, was hier, da sind wir uns sicher, sowieso keinen interessiert. Wieder hält uns der extrem starke und am Abend kalte Wind vom Kochen im Freien ab und wir sind froh, dass wir vor kurzem in einem Baumarkt noch Butan-Gaskartuschen für unseren kleinen Campingkocher gefunden haben, der im Moment fast täglich zum Einsatz kommt, während unsere Außenküche windbedingt kalt bleibt. Für uns ist das (meistens) kein Problem, klar, ab und zu wünscht man sich dann schon ganz kurz mal etwas mehr Platz im
Vorschriften, dass man im Nationalpark nicht einfach irgendwo campen darf, was hier, da sind wir uns sicher, sowieso keinen interessiert. Wieder hält uns der extrem starke und am Abend kalte Wind vom Kochen im Freien ab und wir sind froh, dass wir vor kurzem in einem Baumarkt noch Butan-Gaskartuschen für unseren kleinen Campingkocher gefunden haben, der im Moment fast täglich zum Einsatz kommt, während unsere Außenküche windbedingt kalt bleibt. Für uns ist das (meistens) kein Problem, klar, ab und zu wünscht man sich dann schon ganz kurz mal etwas mehr Platz im Inneren der Kabine, aber sobald dann die Sonne wieder strahlt und wir draußen sitzen, essen und kochen können, was auf unserer Reise bis jetzt, durch unser immenses Wetterglück, fast immer der Fall war, dann sind wir wieder froh, dass es
Inneren der Kabine, aber sobald dann die Sonne wieder strahlt und wir draußen sitzen, essen und kochen können, was auf unserer Reise bis jetzt, durch unser immenses Wetterglück, fast immer der Fall war, dann sind wir wieder froh, dass es  genau so ist wie es ist. Während der Nacht sinkt dann die Temperatur auf einige Minusgrade und zusammen mit der Höhe von ca. 4.800 m, auf der wir uns gerade befinden, braucht der Unimog am nächsten Morgen zum ersten Mal seit langem drei Versuche bevor er, sehr gequält aber dann dann doch, anspringt. Wir fahren weiter, die extreme Piste wird nicht für einen einzigen Kilometer besser, aber dafür bietet sich uns hier auf der „Lagunenroute“ eine Landschaft die ganz sicher eine der spektakulärsten und schönsten der gesamten
genau so ist wie es ist. Während der Nacht sinkt dann die Temperatur auf einige Minusgrade und zusammen mit der Höhe von ca. 4.800 m, auf der wir uns gerade befinden, braucht der Unimog am nächsten Morgen zum ersten Mal seit langem drei Versuche bevor er, sehr gequält aber dann dann doch, anspringt. Wir fahren weiter, die extreme Piste wird nicht für einen einzigen Kilometer besser, aber dafür bietet sich uns hier auf der „Lagunenroute“ eine Landschaft die ganz sicher eine der spektakulärsten und schönsten der gesamten  Reise ist. Berge
Reise ist. Berge  deren Felsen in Regenborgenfarben leuchten, Lagunen deren Wasser von türkis über jadegrün bis zu dunkelblau wechselt, man weiß oft nicht in welche Richtung man zuerst schauen soll. Oft sehen wir kleine Gruppen der sonst so seltenen „Vicunas“ direkt neben der Piste, die aber immer ganz schnell die Flucht ergreifen wenn wir
deren Felsen in Regenborgenfarben leuchten, Lagunen deren Wasser von türkis über jadegrün bis zu dunkelblau wechselt, man weiß oft nicht in welche Richtung man zuerst schauen soll. Oft sehen wir kleine Gruppen der sonst so seltenen „Vicunas“ direkt neben der Piste, die aber immer ganz schnell die Flucht ergreifen wenn wir  uns nähern, was dazu führt dass ich immer nur ihre Hinterteile auf meine Fotos bekomme und es schließlich
uns nähern, was dazu führt dass ich immer nur ihre Hinterteile auf meine Fotos bekomme und es schließlich  aufgebe sie zu fotografieren. Menschen sehen wir wenige, ab und zu begegnen uns ein oder mehrere Jeeps von Tourenabietern, mit denen Touristen, die nicht so ein Glück haben wie wir, über die Route transportiert werden, aber
aufgebe sie zu fotografieren. Menschen sehen wir wenige, ab und zu begegnen uns ein oder mehrere Jeeps von Tourenabietern, mit denen Touristen, die nicht so ein Glück haben wie wir, über die Route transportiert werden, aber die ganze Fahrt über begegnen wir nicht einem einzigen anderen Overlander-Fahrzeug, was uns wirklich wieder einmal extrem wundert. Einen kurzen Stopp machen wir dann bei den „Geotermas Sol de Manana“, sind dann aber
die ganze Fahrt über begegnen wir nicht einem einzigen anderen Overlander-Fahrzeug, was uns wirklich wieder einmal extrem wundert. Einen kurzen Stopp machen wir dann bei den „Geotermas Sol de Manana“, sind dann aber  eher enttäuscht von den paar blubbernden und nach Schwefel stinkenden Schlammlöchern, ich hatte mich auf ein paar wasserspuckende Geysire gefreut, aus denen aber, zumindestens während unseres Besuchs, nur heiße Dampfwolken aufsteigen. Hier toppen wir aber wieder
eher enttäuscht von den paar blubbernden und nach Schwefel stinkenden Schlammlöchern, ich hatte mich auf ein paar wasserspuckende Geysire gefreut, aus denen aber, zumindestens während unseres Besuchs, nur heiße Dampfwolken aufsteigen. Hier toppen wir aber wieder 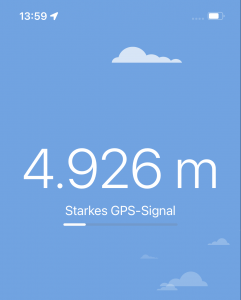 einmal unseren Höhenrekord und befinden uns auf 4.926 m. Sogar hier, mitten in der sandigen, extrem windigen Einsamkeit, auf einer Fahrspur die nur aus Wellblech und Tiefsand
einmal unseren Höhenrekord und befinden uns auf 4.926 m. Sogar hier, mitten in der sandigen, extrem windigen Einsamkeit, auf einer Fahrspur die nur aus Wellblech und Tiefsand  besteht, kommen uns plötzlich wieder einmal zwei völlig verstaubte, aber fröhlich winkende Radfahrer entgegen und ich schüttle wieder einmal den Kopf über so viel sportliche Einsatzbereitschaft. Würde man mich hier mit einem Fahrrad aussetzen, müsste ich wahrscheinlich die bolivianische Staatsangehörigkeit beantragen, denn ich würde wohl niemals mehr aus dieser Wildnis hinauskommen. Riesigen Spaß haben wir dann bei den „Termas de Polques“, wir haben das Becken mit dem wohlig heißen Wasser ganz für uns alleine und genießen es über zwei Stunden lang, im Thermalwasser zu liegen und dabei über die direkt danebenlie
besteht, kommen uns plötzlich wieder einmal zwei völlig verstaubte, aber fröhlich winkende Radfahrer entgegen und ich schüttle wieder einmal den Kopf über so viel sportliche Einsatzbereitschaft. Würde man mich hier mit einem Fahrrad aussetzen, müsste ich wahrscheinlich die bolivianische Staatsangehörigkeit beantragen, denn ich würde wohl niemals mehr aus dieser Wildnis hinauskommen. Riesigen Spaß haben wir dann bei den „Termas de Polques“, wir haben das Becken mit dem wohlig heißen Wasser ganz für uns alleine und genießen es über zwei Stunden lang, im Thermalwasser zu liegen und dabei über die direkt danebenlie gende, farbenprächtige Lagune zu schauen. Einen der schönsten Übernachtungsplätze unserer Lagunentour erreichen wir dann am Abend. Er liegt auf einer Anhöhe zwischen der „Laguna Blanca“ und der „Laguna Verde“, von
gende, farbenprächtige Lagune zu schauen. Einen der schönsten Übernachtungsplätze unserer Lagunentour erreichen wir dann am Abend. Er liegt auf einer Anhöhe zwischen der „Laguna Blanca“ und der „Laguna Verde“, von wo man einen Traumblick auf beide hat und wo wir wieder einmal die einzigen
wo man einen Traumblick auf beide hat und wo wir wieder einmal die einzigen  „Übernachter“ sind. Dafür ist es auch hier am Abend wieder extrem windig und kalt, man braucht das Bier nachts inzwischen nicht mehr in den Kühlschrank zu stellen, es bleibt auch außerhalb richtig kalt. Am nächsten Morgen steige ich bereits bei Sonnenaufgang um 06.00 Uhr aus dem Bett, höre keinen Wind draußen und gehe etwas näher zum Rand der „Laguna verde“ und tatsächlich, es ist genau das eingetreten was ich erhofft hatte: Im klaren, völlig ruhigen Wasser der Lagune spiegelt sich in seiner ganzen Pracht
„Übernachter“ sind. Dafür ist es auch hier am Abend wieder extrem windig und kalt, man braucht das Bier nachts inzwischen nicht mehr in den Kühlschrank zu stellen, es bleibt auch außerhalb richtig kalt. Am nächsten Morgen steige ich bereits bei Sonnenaufgang um 06.00 Uhr aus dem Bett, höre keinen Wind draußen und gehe etwas näher zum Rand der „Laguna verde“ und tatsächlich, es ist genau das eingetreten was ich erhofft hatte: Im klaren, völlig ruhigen Wasser der Lagune spiegelt sich in seiner ganzen Pracht  „der lokale Riese“, der 5.960 m hohe Vulkan „Licancabur“. Ich genieße diesen Augenblick in absoluter Stille und freue mich natürlich auch über das wunderschöne Foto das mir dadurch gelingt, denn schon zehn Minuten später kommt leichter Wind auf und verwischt das klare Bild. Den Touristen, die Stunden später mit den Jeeps der Tourenanbieter hier auftauchen, bleiben solche außergewöhnlichen Anblicke wie so oft verwehrt und wieder einmal genieße ich das Glück unserer Reise und vor allem, dass wir alle diese fantastischen Plätze alleine und zu den von uns gewünschten Zeiten besuchen können und auch dort wo es schön ist so lange bleiben können wie wir wollen. Anstatt der Lagune ist dann auch hier, wie so oft, unser Unimog das meistbegehrte Foto-Objekt der Touristen und ich möchte nur 50 Cent für jedes Foto das in den letzten 20 Monaten vom Unimog geschossen wurde, dann könnten wir zwei gleich noch ein paar weitere Jahre des Reisens anhängen! Da wir heute die Grenze zu Chile überqueren werden, verschenke ich dann unser letztes Säckchen mit Coca-Blättern an einen der Chauffeure der Touren-Jeeps, der sich riesig darüber freut und sich gleich eine ordentliche Ladung davon in seine Backe schiebt. Na ja, beim täglichen Umgang mit Touristen kein
„der lokale Riese“, der 5.960 m hohe Vulkan „Licancabur“. Ich genieße diesen Augenblick in absoluter Stille und freue mich natürlich auch über das wunderschöne Foto das mir dadurch gelingt, denn schon zehn Minuten später kommt leichter Wind auf und verwischt das klare Bild. Den Touristen, die Stunden später mit den Jeeps der Tourenanbieter hier auftauchen, bleiben solche außergewöhnlichen Anblicke wie so oft verwehrt und wieder einmal genieße ich das Glück unserer Reise und vor allem, dass wir alle diese fantastischen Plätze alleine und zu den von uns gewünschten Zeiten besuchen können und auch dort wo es schön ist so lange bleiben können wie wir wollen. Anstatt der Lagune ist dann auch hier, wie so oft, unser Unimog das meistbegehrte Foto-Objekt der Touristen und ich möchte nur 50 Cent für jedes Foto das in den letzten 20 Monaten vom Unimog geschossen wurde, dann könnten wir zwei gleich noch ein paar weitere Jahre des Reisens anhängen! Da wir heute die Grenze zu Chile überqueren werden, verschenke ich dann unser letztes Säckchen mit Coca-Blättern an einen der Chauffeure der Touren-Jeeps, der sich riesig darüber freut und sich gleich eine ordentliche Ladung davon in seine Backe schiebt. Na ja, beim täglichen Umgang mit Touristen kein  Wunder, da greift man, wie man ja aus eigener Erfahrung weiß, zwischendurch schon mal auf jede Art von Beruhigungsmitteln zurück… ! Da die Coca-Blätter
Wunder, da greift man, wie man ja aus eigener Erfahrung weiß, zwischendurch schon mal auf jede Art von Beruhigungsmitteln zurück… ! Da die Coca-Blätter  überall außerhalb von Peru und Bolivien unter das Suchtmittelgesetz fallen, hätte ich sie sowieso vor der Grenze entsorgen müssen und so erfüllen sie noch einen guten Zweck, auch wenn die Touristen, die gerade wieder in den Jeep steigen, die Übergabe mit etwas schrägen Blicken verfolgen. Wir machen uns dann auf den Weg in Richtung des bolivianischen Zolls, der in völliger Einsamkeit auf 4.370 m liegt, viel los ist hier
überall außerhalb von Peru und Bolivien unter das Suchtmittelgesetz fallen, hätte ich sie sowieso vor der Grenze entsorgen müssen und so erfüllen sie noch einen guten Zweck, auch wenn die Touristen, die gerade wieder in den Jeep steigen, die Übergabe mit etwas schrägen Blicken verfolgen. Wir machen uns dann auf den Weg in Richtung des bolivianischen Zolls, der in völliger Einsamkeit auf 4.370 m liegt, viel los ist hier  logischerweise nicht, die Papiere für den Unimog werden gestempelt und er darf somit offiziell das Land wieder verlassen. Zur Immigration, wo wir als Personen noch offiziell ausreisen müssen, sind es dann noch ein
logischerweise nicht, die Papiere für den Unimog werden gestempelt und er darf somit offiziell das Land wieder verlassen. Zur Immigration, wo wir als Personen noch offiziell ausreisen müssen, sind es dann noch ein paar letzte Kilometer Waschbrettpiste extrem und als wir dort ankommen, sieht alles total verlassen aus. Es gibt keine Schranke, was ja auch unsinnig wäre in diesem ringsherum offenen Gebiet und man ist absolut versucht, einfach weiterzufahren, aber wir wissen, wir brauchen unbedingt die Ausreisestempel in unsere Pässe. Also klopfen wir rundherum an die Fenster und Türen des Gebäudes, aber nichts tut sich. Dann gehe ich zur Rückseite und – aha – da sitzen sie ja! Die ganze Belegschaft genießt die Sonne und hat sich auch von unserem Klopfen und Rufen einfach nicht dabei stören lassen. Als ich sie dann trotzdem aufstöbere, bequemt sich einer aber doch noch dazu, mit unseren Pässen hineinzugehen und sie uns dann durch ein Fenster gestempelt wieder herauszugeben. Geht doch!
paar letzte Kilometer Waschbrettpiste extrem und als wir dort ankommen, sieht alles total verlassen aus. Es gibt keine Schranke, was ja auch unsinnig wäre in diesem ringsherum offenen Gebiet und man ist absolut versucht, einfach weiterzufahren, aber wir wissen, wir brauchen unbedingt die Ausreisestempel in unsere Pässe. Also klopfen wir rundherum an die Fenster und Türen des Gebäudes, aber nichts tut sich. Dann gehe ich zur Rückseite und – aha – da sitzen sie ja! Die ganze Belegschaft genießt die Sonne und hat sich auch von unserem Klopfen und Rufen einfach nicht dabei stören lassen. Als ich sie dann trotzdem aufstöbere, bequemt sich einer aber doch noch dazu, mit unseren Pässen hineinzugehen und sie uns dann durch ein Fenster gestempelt wieder herauszugeben. Geht doch!
Somit verlassen wir offiziell Bolivien, das uns, speziell durch die Dieselknappheit, doch etwas mehr an Geduld und Anpassungsfähigkeit abverlangt hat als andere Länder davor. Wenn ich jetzt an die Zeit dort zurückdenke, taucht vor mir ein Bild von braunen Farbtönen auf. Noch nie waren wir vorher in einem Land das durchwegs aus brauner Landschaft zu bestehen schien. Natürlich, durch das Problem mit dem Diesel, sind wir nicht ins Tiefland gefahren, wo die Vegetation des Dschungels sicher für Abwechslung gesorgt hätte, aber so ist es einfach das, was bei mir in der Erinnerung hängengeblieben ist. Als gefährlich oder unsicher haben wir auch dieses Land überhaupt nicht empfunden, sondern wir haben uns überall und jederzeit frei und sicher gefühlt. Den Straßenhundebanden,  von denen man immer wieder hört dass sie auch Menschen bedrohen, sind wir oft begegnet, jedoch immer nur am Tag, wo die wirklich teils riesigen Tiere eher schläfrig herumliegen. Nachts aber konnten wir ab und zu vom Unimog aus beobachten, mit welcher Vehemenz sie dann ihre Reviere verteidigen und dabei wären wir ihnen ganz sicher nur im äußersten Notfall über den Weg gelaufen. Die Menschen Boliviens die wir im Alltag unserer Reise getroffen haben, waren nicht unfreundlich, aber auch weit weg von herzlich oder aufgeschlossen. Die paar die im fast nicht vorhandenen Tourismus arbeiten, haben sich allesamt unglaublich um uns bemüht und haben uns am Ende auch immer wieder gebeten: „Bitte erzählt Euren Freunden von uns, bitte schickt uns mehr Touristen, wir brauchen sie unbedingt!“ Wir wünschen es ihnen von Herzen, aber so lange der Staat nicht für eine entsprechende Infrastruktur sorgt, wird daraus wohl nicht viel werden. Absolut positiv bleibt uns in Erinnerung, wie günstig wir in Bolivien gelebt haben, egal ob beim Besuch der schönen Lokalen in der symphatischen Hauptstadt „Sucre“, beim Einkauf in den Supermärkten oder wenn es dann halt doch wieder einmal die panierten Hendl vom Straßenstand sein mußten – Fast alles war hier um einiges günstiger als in jedem Land das wir auf unserer Reise bisher besucht haben. Einer der absoluten Höhepunkte für uns war natürlich der Tag auf dem wirklich einzigartigen „Salar de Uyuni“, aber riesigen Eindruck hat auch der Besuch der Minen von „Potosí“ bzw. der unglaubliche Einsatz der Menschen die dort jeden Tag ihr Leben riskieren, in uns
von denen man immer wieder hört dass sie auch Menschen bedrohen, sind wir oft begegnet, jedoch immer nur am Tag, wo die wirklich teils riesigen Tiere eher schläfrig herumliegen. Nachts aber konnten wir ab und zu vom Unimog aus beobachten, mit welcher Vehemenz sie dann ihre Reviere verteidigen und dabei wären wir ihnen ganz sicher nur im äußersten Notfall über den Weg gelaufen. Die Menschen Boliviens die wir im Alltag unserer Reise getroffen haben, waren nicht unfreundlich, aber auch weit weg von herzlich oder aufgeschlossen. Die paar die im fast nicht vorhandenen Tourismus arbeiten, haben sich allesamt unglaublich um uns bemüht und haben uns am Ende auch immer wieder gebeten: „Bitte erzählt Euren Freunden von uns, bitte schickt uns mehr Touristen, wir brauchen sie unbedingt!“ Wir wünschen es ihnen von Herzen, aber so lange der Staat nicht für eine entsprechende Infrastruktur sorgt, wird daraus wohl nicht viel werden. Absolut positiv bleibt uns in Erinnerung, wie günstig wir in Bolivien gelebt haben, egal ob beim Besuch der schönen Lokalen in der symphatischen Hauptstadt „Sucre“, beim Einkauf in den Supermärkten oder wenn es dann halt doch wieder einmal die panierten Hendl vom Straßenstand sein mußten – Fast alles war hier um einiges günstiger als in jedem Land das wir auf unserer Reise bisher besucht haben. Einer der absoluten Höhepunkte für uns war natürlich der Tag auf dem wirklich einzigartigen „Salar de Uyuni“, aber riesigen Eindruck hat auch der Besuch der Minen von „Potosí“ bzw. der unglaubliche Einsatz der Menschen die dort jeden Tag ihr Leben riskieren, in uns  hinterlassen. Und der krönende Abschluss war sicherlich die abschließende Fahrt über die „Lagunenroute“, die uns Bilder geboten hat, wie wir sie in dieser Geballtheit noch nie auf unserer Reise gesehen haben. Wir haben es keine Sekunde bereut, uns auf die Befahrung dieser Route eingelassen zu haben, obwohl man das, unserer Meinung nach, wirklich nur mit einem Fahrzeug machen sollte, auf das man sich hundertprozentig verlassen kann, denn in dieser Einsamkeit und vor allem abseits der Hauptroute ein Problem zu kriegen, das wünschen wir wirklich niemandem. Wir zwei machen uns jetzt aber endgültig auf den Weg über das letzte Stück dieser Strecke, es sind noch einige Kilometer durch das Niemandsland bis zum ebenfalls noch hoch oben in der Wüste des „Altiplanos“ liegenden Grenzposten der Chilenen – Aber das ist dann schon wieder eine andere Geschichte… !
hinterlassen. Und der krönende Abschluss war sicherlich die abschließende Fahrt über die „Lagunenroute“, die uns Bilder geboten hat, wie wir sie in dieser Geballtheit noch nie auf unserer Reise gesehen haben. Wir haben es keine Sekunde bereut, uns auf die Befahrung dieser Route eingelassen zu haben, obwohl man das, unserer Meinung nach, wirklich nur mit einem Fahrzeug machen sollte, auf das man sich hundertprozentig verlassen kann, denn in dieser Einsamkeit und vor allem abseits der Hauptroute ein Problem zu kriegen, das wünschen wir wirklich niemandem. Wir zwei machen uns jetzt aber endgültig auf den Weg über das letzte Stück dieser Strecke, es sind noch einige Kilometer durch das Niemandsland bis zum ebenfalls noch hoch oben in der Wüste des „Altiplanos“ liegenden Grenzposten der Chilenen – Aber das ist dann schon wieder eine andere Geschichte… !